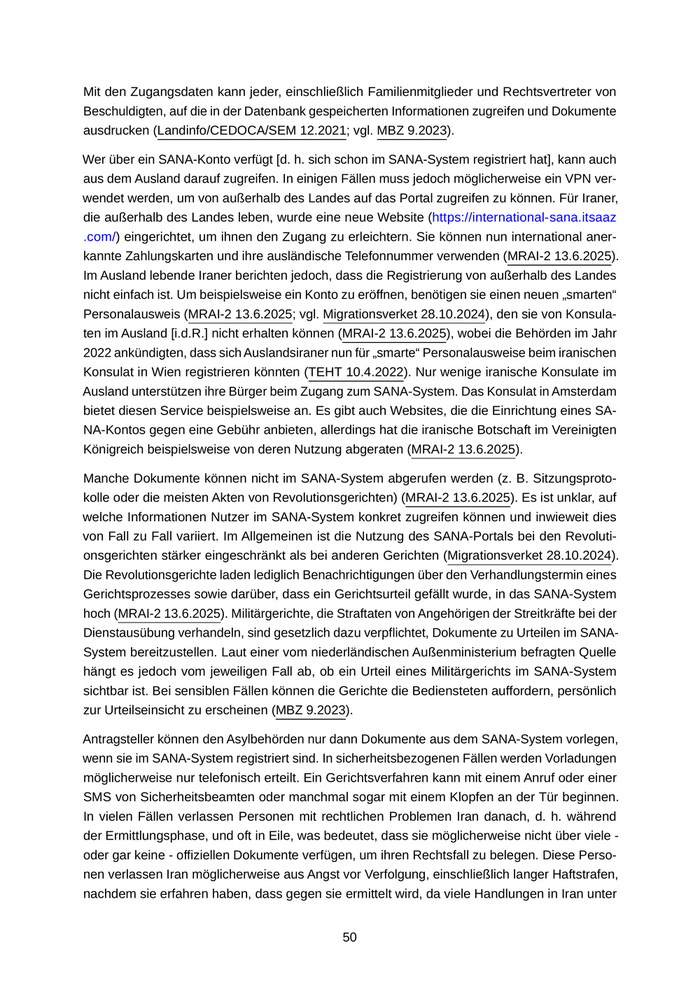2025-09-09-coi-cms-laenderinformationen-iran-version-10-33ca
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Länderinformationsblätter“
■ Soltani/Shooshinasab - Soltani, Mohammad, Shooshinasab, Nafiseh (8.2022): UPDATE: An Over view of the Iranian Legal System, https://www.nyulawglobal.org/globalex/Iran_Legal_System_Rese arch1.html, Zugriff 15.12.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (23.4.2024): 2023 Country Report on Human Rights Practices: Iran, https://www.ecoi.net/de/dokument/2107731.html, Zugriff 3.5.2024 5.1 Gerichte Letzte Änderung 2025-07-17 12:30 Die iranische Justiz verwaltet ein vielschichtiges Gerichtssystem. Die Strafverfolgung geht von niedrigeren Gerichten aus und kann bei höheren Gerichten angefochten werden. Der Oberste Gerichtshof überprüft Fälle von Kapitalverbrechen und entscheidet über Todesurteile. Er hat auch die Aufgabe, für die ordnungsgemäße Anwendung der Gesetze und die Einheitlichkeit der Gerichtsverfahren zu sorgen (USIP 1.8.2015). Bestimmte Urteile können vor dem Obersten Gerichtshof angefochten werden (Soltani/Shooshinasab 8.2022; vgl. Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021). Anders als die Berufungsgerichte ist der Oberste Gerichtshof nicht befugt, ein neues Urteil zu fällen. Im Falle einer erfolgreichen Anfechtung verweist er den betroffenen Fall wieder an ein zuständiges Gericht zurück (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021). Es gibt allgemeine und spezielle Gerichte. Die allgemeinen Gerichte haben die Rechtspre chungskompetenz in allen Fällen, die nicht im Kompetenzbereich der speziellen Gerichte liegen (Soltani/Shooshinasab 8.2022). Sie verteilen sich auf die kleineren Landkreise, Rayons und Bezirke des Landes (IRWIRE 9.9.2020). Seit 2001 gibt es darüber hinaus sogenannte Streitschlichtungsräte (shurāhā-I hal-e ikhtilāf) als alternative Konfliktlösungskörperschaften. Die Richter dieser Räte können in Abstimmung mit den Ratsmitgliedern in bestimmten Fragen in den Bereichen Finanzen, Miete, Erbschaft, Mitgift und Unterhalt sowie bestimmten ta’zir-Vergehen [s. Unterkap. Rechtsschutz / Justizwesen / Islamisches Strafgesetzbuch (IStGB), Strafzumessungspraxis f. Begriffserklärung] Fälle anhö ren und Urteile sprechen. Sie können aber z. B. keine Scheidungsfragen behandeln und sind auch nicht dazu befugt, Körper- oder Haftstrafen auszusprechen. Die Zuständigkeit der Streit beilegungsräte in den Dörfern beschränkt sich auf Friedens- und Kompromissentscheidungen (Soltani/Shooshinasab 8.2022). Die Zivilgerichte verhandeln über lokale materielle und immaterielle zivilrechtliche Streitigkeiten, die nicht in die Zuständigkeit der Streitschlichtungsräte fallen (Soltani/Shooshinasab 8.2022). Die Familiengerichte entscheiden unter anderem bei Ehe- und Scheidungsfragen, Obsorge [Anm.: jedoch nicht Vormundschaft] wie auch geschlechtsangleichenden Operationen. Die Urtei le werden von einem männlichen Richter gefällt, nachdem er eine beratende Richterin schriftlich konsultiert hat (Soltani/Shooshinasab 8.2022). Die Strafgerichte unterteilen sich in verschiedene Untereinheiten (IRWIRE 9.9.2020). Neben den Strafgerichten 1 und 2 gibt es die Revolutionsgerichte, Jugendgerichte und Militärgerichte (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021; vgl. Soltani/Shooshinasab 8.2022). Darüber hinaus gibt es mehrere Sondergerichte (IRWIRE 9.9.2020), darunter beispielsweise ein Sondergericht für die 41
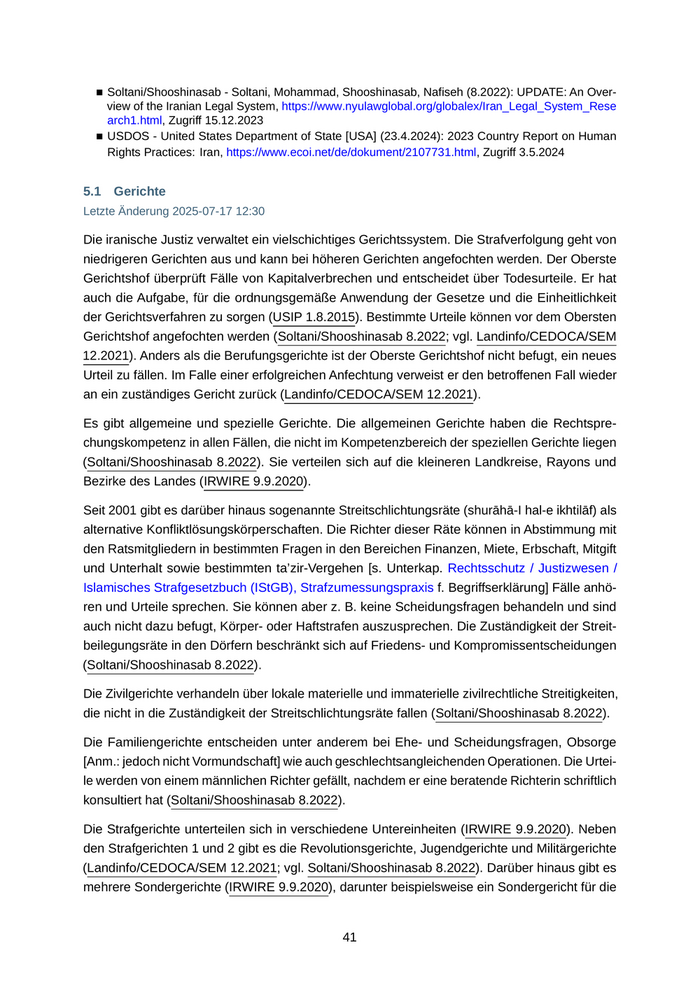
Geistlichkeit (dadgah-e vīzheh-ye rouhaniyat), das als einziges Gericht nicht dem Justizchef, sondern direkt dem Revolutionsführer untersteht (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021). Es wird u. a. dazu genutzt, um prominente Kleriker, welche Kritik am Regime äußern, strafrechtlich zu verfolgen (IRWIRE 9.9.2020; vgl. USIP 1.8.2015). Das Gesetz ermöglicht auch die Einsetzung eines zuständigen Gerichts zur Behandlung von Verstößen gegen das Pressegesetz von 1986 - das sogenannte Pressegericht (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021). Revolutionsgerichte Die Revolutionsgerichte haben verschiedene Zweige in der Hauptstadt, in den Provinzen und in manchen Justizdistrikten (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021). Die Verfassung sieht weder ihre Einrichtung noch ein Mandat für die Revolutionsgerichte vor. Sie wurden ursprünglich nach der Revolution von 1979 geschaffen, um hochrangige Beamte der abgesetzten Monarchie vor Ge richt zu stellen, und wurden später institutionalisiert. Sie arbeiten weiterhin parallel zum restlichen Strafjustizsystem (USDOS 23.4.2024) und sind stark von den Sicherheitsbehörden beeinflusst (MRAI 19.6.2023) bzw. gehen manche Quellen davon aus, dass die Revolutionsgerichte in Zu sammenarbeit mit den Revolutionsgarden und dem Geheimdienstministerium (MOIS) operieren (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021). Die Revolutionsgerichte unterscheiden sich bezüglich der Angelegenheiten, welche sie behan deln, von anderen Gerichten. Sie befassen sich in erster Linie mit Straftaten im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit, was im Grunde alle politischen und sozialen Aktivitäten von Dis sidenten und Menschenrechtsaktivisten einschließt (MRAI 19.6.2023). Nach Art. 303 der IStPO fallen die folgenden Delikte unter die Zuständigkeit der Revolutionsgerichte (FIDH 9.2023): • Alle Verbrechen gegen die nationale und internationale Sicherheit, mohārebeh (Waffenauf nahme gegen Gott und Staat) oder baghei (bewaffneter Aufstand gegen die Regierung) (Soltani/Shooshinasab 8.2022; vgl. IRWIRE 9.9.2020) und efsād fe-l-arz [Korruption auf Erden] - jeweils definiert und kriminalisiert in den Artikeln 279 bis 285 und 286 bis 288 des islamischen Strafgesetzbuchs von 2013 (IStGB) (Soltani/Shooshinasab 8.2022), Rebellion, geheime Absprachen und Versammlungen gegen die Islamische Republik Iran oder bewaff nete Aktionen, Brandanschläge, Zerstörung und Verschwendung von Eigentum, um sich gegen das Regime zu stellen (Soltani/Shooshinasab 8.2022; vgl. JIS 8.9.2018); • Spionage gegen das Regime (JIS 8.9.2018), Spionage im Auftrag von Ausländern (Art. 502 IStGB) (FIDH 9.2023); • Beleidigung des Gründers der Islamischen Republik Iran und des Obersten Führers (Art. 514) (FIDH 9.2023; vgl. JIS 8.9.2018); • Alle Straftaten im Zusammenhang mit Drogen, psychotropen Stoffen und deren Vorläu fersubstanzen sowie dem Schmuggel von Waffen, Munition und anderen einschlägigen Gegenständen (Soltani/Shooshinasab 8.2022; vgl. JIS 8.9.2018); 42
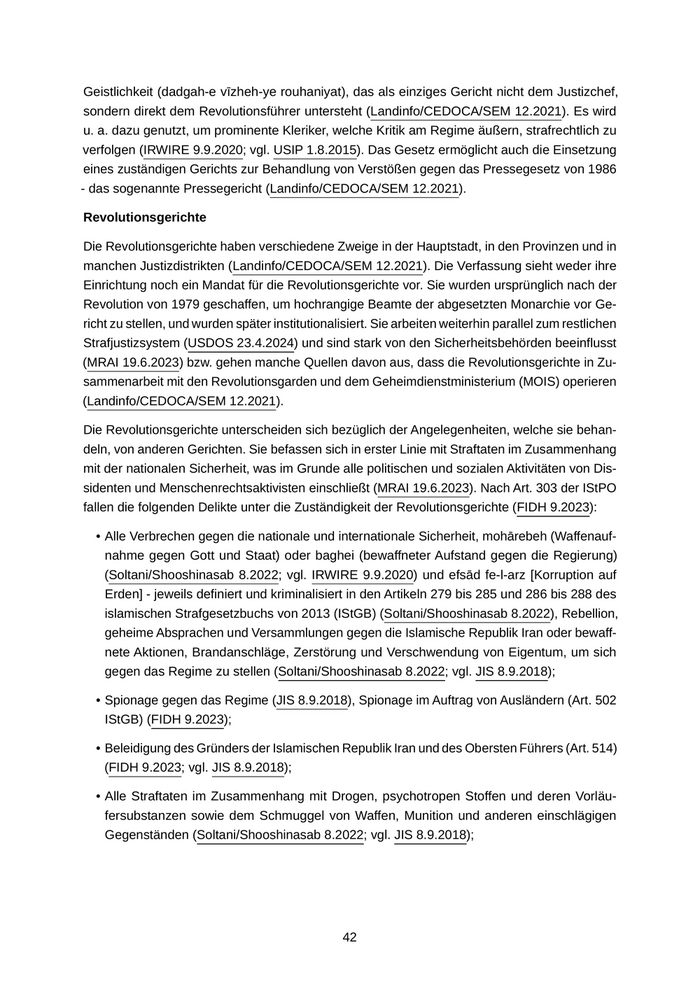
• Andere Fälle, für die laut Gesetz das Revolutionsgericht zuständig ist (Soltani/Shooshinasab 8.2022): z. B. in Art. 49 der Verfassung erwähnte Delikte wie Bestechung, Korruption, Unter schlagung öffentlicher Mittel und Verschwendung von Volksvermögen (JIS 8.9.2018; vgl. Sol tani/Shooshinasab 8.2022). Während es an allen iranischen Gerichten bestimmte Probleme gibt, sind die Revolutionsge richte besonders dafür berüchtigt, selbst die grundlegendsten Rechte nicht einzuhalten (MRAI 19.6.2023). Laut Menschenrechtsgruppen und internationalen Beobachtern werden vor Revo lutionsgerichten, die im Allgemeinen die Fälle politischer Gefangener anhören, routinemäßig grob unfaire Gerichtsprozesse ohne ordnungsgemäße Verfahren abgehalten; es werden vor ab festgelegte Urteile verkündet und Hinrichtungen für politische Zwecke befürwortet. Diese unlauteren Praktiken treten Berichten zufolge in allen Phasen der Strafverfahren vor den Revo lutionsgerichten auf (USDOS 23.4.2024). Anwälte benötigen vor Revolutionsgerichten in der Regel schon alleine dafür eine Erlaubnis der Richter, um den Gerichtssaal betreten zu können. Anwälten von Personen, die in der Vergangen heit wegen mohārebeh angeklagt waren, wurde manchmal die Teilnahme am Prozess verweigert. In anderen sicherheitsrelevanten Fällen durften sie teilnehmen, aber ihr Recht auf eine ange messene Verteidigung wurde eingeschränkt (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021). Eine Novelle der Strafprozessordnung im Jahr 2015 höhlte die ohnehin begrenzten Beschuldigtenrechte bei Prozessen wegen Vergehen gegen die nationale Sicherheit weiter aus. Den Beschuldigten und ihren Anwälten wurde mit der Novelle beispielsweise das Recht auf eine Kopie der Gerichts akten verweigert (MRAI 19.6.2023) und Angeklagte dürfen zumindest im Anfangsstadium des Verfahrens (AA 15.7.2024) - dem Untersuchungsstadium (MRAI 19.6.2023) - nur aus einer Liste mit vom Staat zugelassenen und damit mutmaßlich systemfreundlichen Anwälten auswählen (AA 15.7.2024; vgl. MRAI 19.6.2023). In dieser bedeutsamen Prozessphase werden oftmals sensible Informationen aufgedeckt, diese Einschränkung der Auswahl gibt Anlass zur Sorge über die Fairness und Transparenz der Prozesse (MRAI 19.6.2023). Quellen ■ AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (15.7.2024): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran (Stand: 03. April 2024), https://www.ecoi.net/en/file/local/211 2796/Auswärtiges_Amt,_Bericht_über_die_asyl-_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islami schen_Republik_Iran,_15.07.2024.pdf, Zugriff 25.7.2024 ■ FIDH - International Federation for Human Rights (9.2023): The Iran Notes, https://www.fidh.org/I MG/pdf/iran_notes_-_1_-_judiciary_-_september_2023.pdf , Zugriff 3.5.2024 ■ IRWIRE - IranWire (9.9.2020): Injustice Behind Closed Doors: Iran’s Special and Revolutionary Courts, https://iranwire.com/en/features/67558/, Zugriff 30.3.2023 ■ JIS - Journal for Iranian Studies (8.9.2018): THE REVOLUTIONARY COURTS IN IRAN: LEGALITY AND POLITICAL MANIPULATION, https://rasanah-iiis.org/english/wp-content/uploads/sites/2/2020/ 02/THE-REVOLUTIONARY-COURTS-IN-IRAN.pdf , Zugriff 30.3.2023 ■ Landinfo/CEDOCA/SEM - Referat für Länderinformationen der Einwanderungsbehörde [Norwegen], Center for Documentation and Research of the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons [Belgien], Staatssekretariat für Migration [Schweiz] (12.2021): IRAN Criminal procedures and documents, https://www.ecoi.net/en/file/local/2064888/joint_coi_report._criminal_pr ocedures_and_documents_20211206.pdf, Zugriff 17.3.2023 ■ MRAI - Menschenrechtsanwältin aus Iran (19.6.2023): Interview, via Videotelefonie 43
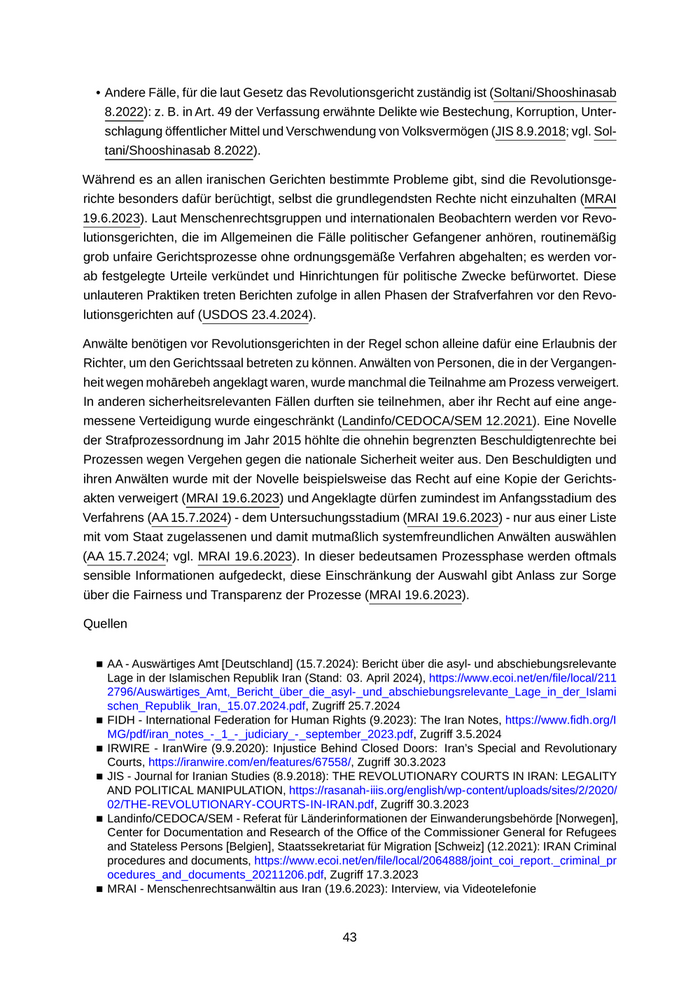
■ Soltani/Shooshinasab - Soltani, Mohammad, Shooshinasab, Nafiseh (8.2022): UPDATE: An Over view of the Iranian Legal System, https://www.nyulawglobal.org/globalex/Iran_Legal_System_Rese arch1.html, Zugriff 15.12.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (23.4.2024): 2023 Country Report on Human Rights Practices: Iran, https://www.ecoi.net/de/dokument/2107731.html, Zugriff 3.5.2024 ■ USIP - United States Institute of Peace [USA] (1.8.2015): The Islamic Judiciary, https://iranprimer.u sip.org/resource/islamic-judiciary, Zugriff 30.3.2023 5.2 Islamisches Strafgesetzbuch (IStGB), Strafzumessungspraxis Letzte Änderung 2025-07-16 08:20 Die iranische Justiz ist insofern ein einzigartiges System, als sie islamische Prinzipien und eine vom französischen System inspirierte Gesamtstruktur kombiniert. Nach der islamischen Revolution wurde das Justizsystem stark verändert, um die Scharia einzubeziehen. Das neue System wurde jedoch auf einer bereits bestehenden säkularen Struktur aufgebaut, wodurch ein sehr komplexes Justizwesen entstanden ist (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021). Mit der islamischen Revolution von 1979 kam es zur Wiedereinführung des islamischen Straf rechts, das die bisherige, vom „ code pénal napoléon“ von 1810 beeinflusste Gesetzgebung ablöste (BAMF 5.2021). Die Schwere und Art einer Straftat sowie die vorgeschriebene Strafe bestimmen, welches Gericht für die Entscheidung eines Falles zuständig ist. Art. 14 des Isla mischen Strafgesetzbuches (IStGB) unterteilt Verbrechen in vier Strafkategorien gemäß der Scharia: hadd, qisas, diyah und ta’zīr (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021). Hadd-Delikte umfassen Unzucht/Ehebruch (zina), Sodomie (levat), lesbische Beziehung (mo saheqeh), Beschaffung von Prostitution (qavadī), falsche Anschuldigung der Unzucht/Sodomie (qazf), Verleumdung des Propheten (sabb-e nabī), Alkoholkonsum (shorb-e khamr), Raub/Dieb stahl, Waffennahme gegen Gott (mohārebeh ba khoda), Korruption auf Erden (mofsad/efsad fe-l-arz) und Rebellion (baghei). Zu den hadd-Strafen gehören die Todesstrafe, auch in Form von Steinigung oder Kreuzigung, Auspeitschung, Amputation (von Hand und Fuß), lebenslange Haft und Verbannung. Art und Umfang dieser Strafen werden vom islamischen Recht bestimmt und gelten als von Gott festgelegt, sie können daher von einem Richter nicht abgeändert oder die Verurteilten begnadigt werden (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021). Iranische Aktivisten und Dissidenten, darunter Angehörige ethnischer und religiöser Minder heiten, werden normalerweise mit vage formulierten und weit gefassten Anklagen konfrontiert, die aus dem IStGB stammen. Die hadd-Verbrechen „ Waffennahme gegen Gott“ (mohārebeh) und „ Korruption auf Erden“ (efsād fe-l-arz) sind dabei die berüchtigtsten (Landinfo/CEDOCA/ SEM 12.2021). Manche Interpretationen von „ Waffennahme gegen Gott“ (mohārebeh) schlie ßen selbst Messer als Waffen ein. Es kann daher passieren, dass Personen des mohārebeh beschuldigt werden, weil sie ein Messer bei sich trugen. Dieser Straftatbestand wird insbeson dere gegen Minderheitengruppen wie Mitglieder der kurdischen Gemeinschaft verwendet, wenn ihnen Verbindungen zu militanten Gruppierungen vorgeworfen werden. Mofsad/efsad fe-l-arz („ Korruption auf Erden“) ist dagegen eine völlig andere Kategorie. Die Definition dieses Begriffs obliegt dem jeweiligen Richter. Dies kann sexuelle Vergehen ebenso einschließen, wie Wirt schaftskriminalität, wenn die Handlung als so schwerwiegend interpretiert wird, dass sie eine 44
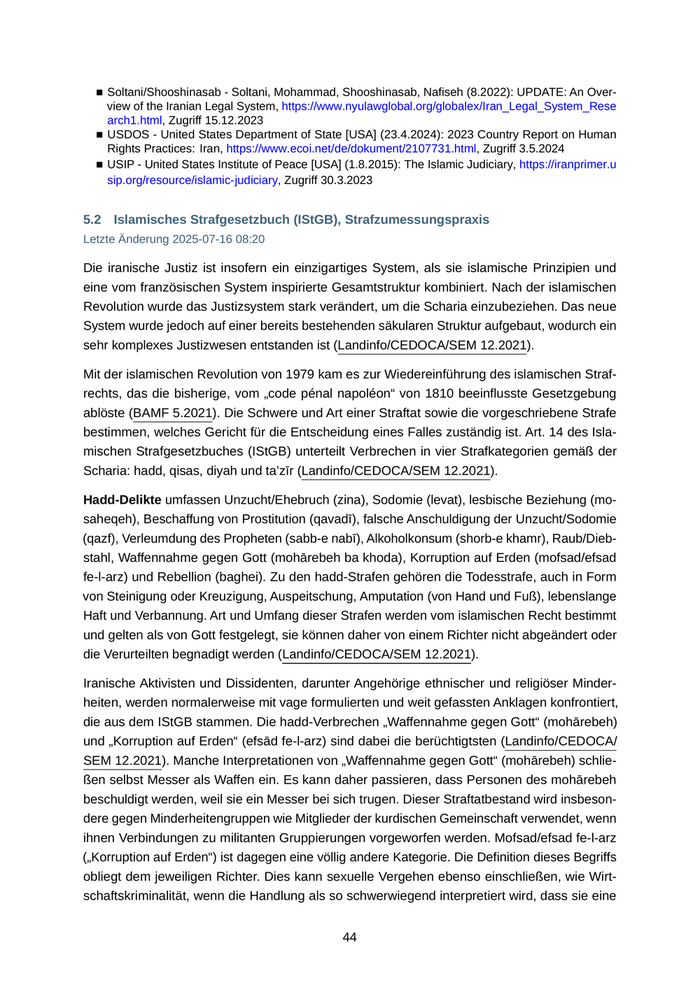
ernsthafte Bedrohung für die Gesellschaft darstellt (MRAI 19.6.2023). Hadd-Strafen werden im zweiten Buch des IStGB (Art. 217–288) behandelt (BAMF 5.2021). Qisas-Vebrechen sind sogenannte Talions- oder Vergeltungsstrafen (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021; vgl. BAMF 5.2021). Sie basieren auf einem Prinzip des islamischen Rechts, den Opfern eine analoge Vergeltung für Gewaltverbrechen wie Totschlag oder Körperverletzung zu erlauben - unter der Voraussetzung, dass die Taten vorsätzlich waren. Angehörige eines Tötungsopfers (nächste Familienangehörige) und Opfer von Körperverletzung können anstelle von Vergeltung auch Geldentschädigung (diyah oder Blutgeld) fordern und die Freilassung des Täters veran lassen. Sie können dem Täter auch ganz vergeben und auf diyah verzichten. Das iranische Rechtssystem betrachtet diese Verbrechen als Angelegenheit zwischen Privatpersonen. Die Rolle des Staates besteht darin, die Ermittlungen und Gerichtsverfahren in diesen Fällen zu erleichtern und sicherzustellen, dass nachfolgende Bestrafungen in organisierter Form erfolgen. Doch selbst wenn die Bluträcher auf ihren Anspruch auf Vergeltung verzichten, kann der Staat eine zusätzliche Strafe verhängen, wenn er der Ansicht ist, dass das Verbrechen die öffentliche Ordnung und die Sicherheit der Gesellschaft stört (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021). In Fällen von Körperverletzung ist Vergeltung selten. Auch bei Mord ist es für die Angehörigen oftmals attraktiver, diyah anzunehmen. Bei nicht vorsätzlicher Körperverletzung oder Totschlag ist diyah dagegen grundsätzlich vorgesehen (und nicht nur als Alternative zu Vergeltung, so die Opfer oder ihre Angehörigen zustimmen). Diyah wird weiters auch in manchen Fällen der vorsätzlichen Körperverletzung angewendet, in denen Vergeltung verboten oder undurchführbar ist (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021). Qisas-Strafen werden im dritten Buch (Art. 289–447) und das Blutgeld bzw. diyah im vierten Buch (Art. 448–728) des IStGB behandelt (BAMF 5.2021). Für alle sonstigen aus Sicht der Rechtsordnung strafwürdigen Taten sind ta’zīr-Strafen (BAMF 5.2021; vgl Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021) - Ermessensstrafen - und sogenannte „Abschre ckungsstrafen“ (mojāzāt-e bāzdārandeh) vorgesehen. Letztere dienen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Während hadd, qisas und diyah durch islamisches Recht definiert werden, leiten sich ta’zir- und Abschreckungsstrafen aus dem staatlichen Recht ab. In diese Kategorien fallen zum Beispiel Straftaten gegen die interne und externe Sicherheit des Staates (Art. 498- 512 und 610-611 IStGB); Fälschung (Art. 523-542 IStGB); Vergehen gegen öffentliche Moral und Anstand (Art. 637-641 IStGB) - beispielsweise ungehörige Beziehungen zwischen Männern und Frauen, wie z. B. Berührungen und Küsse (Art. 637) oder unislamische Kleidung (Art. 638); Diebstahl (Art. 651-667 IStGB); sowie öffentliche Konsumation von Alkohol, Glücksspiel und Vagabundieren (Art. 701-713 IStGB). Ta’zīr-Strafen werden nach Ermessen des Richters (auf der Grundlage des kodifizierten Rechts) verhängt (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021). Aufgrund der Schwere von hadd-Strafen und der Tatsache, dass sie unveränderlich sind, gelten für sie strenge Beweis- und andere Anforderungen (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021), wie zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Zeugen oder wiederholte Geständnisse. Darüber hinaus gibt es jedoch auch die Beweisregelung des „ richterlichen Wissens“ (‘elm-e qāzī) (Landinfo/ CEDOCA/SEM 12.2021; vgl. MRAI 19.6.2023), die in vielen hadd-Fällen angewandt wird (MRAI 19.6.2023) - wobei die NGO Iran Human Rights (IHRNGO) auch von einem Fall berichtete, bei 45
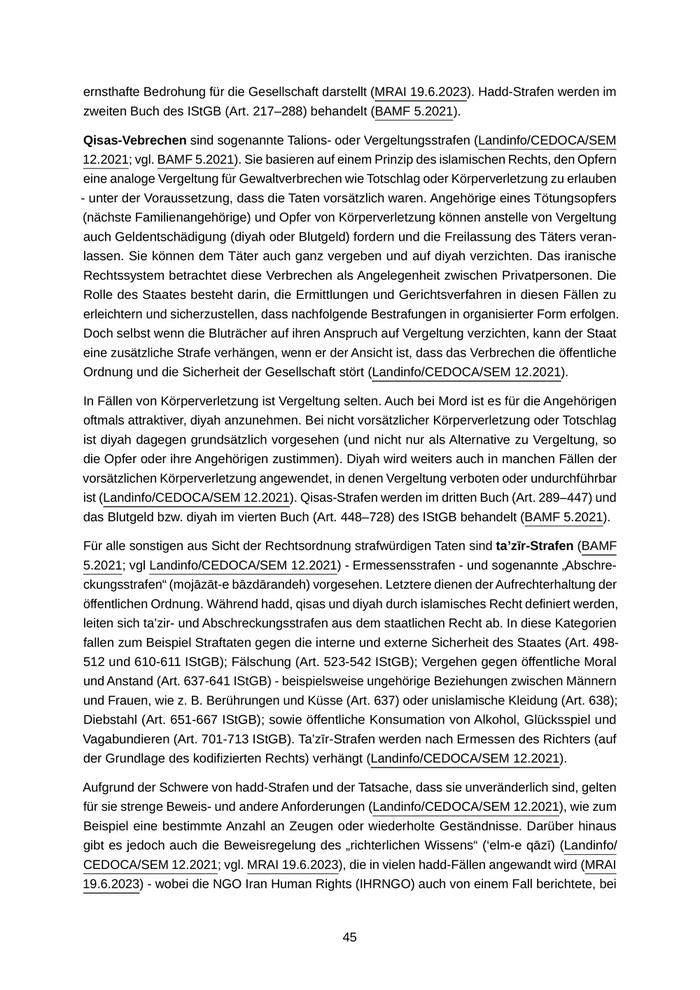
dem eine Verurteilung nach diesem Prinzip aufgrund eines qisas-Vergehens (Mord) erfolgte (IHRNGO 20.2.2025).‘elm-e qāzī bedeutet, dass der Richter auf Grundlage von Indizien ent scheiden muss, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht (MRAI 19.6.2023). Während das Gesetz vorschreibt, dass Urteile, die auf dem „ Wissen“ eines Richters beruhen, auf Beweisen oder Indizien fußen müssen und nicht nur auf der persönlichen Überzeugung des Richters, dass der Angeklagte der Straftat schuldig ist, hat IHRNGO Fälle einer willkürlichen Anwendung von ‘elm-e qāzī dokumentiert (IHRNGO 20.2.2025). Eine Strafrechtsnovelle im Jahr 2013 hat die Anwendung von ‘elm-e qāzī bei Ehebruchsfällen abgeschwächt. Bei Anklagen aufgrund der hadd-Tatbestände mohārebeh und mofsad/efsād fe-l-arz ist das „ richterliche Wissen“ immer noch einer der Hauptfaktoren zur Ermittlung der Schuld oder Unschuld eines Angeklagten (MRAI 19.6.2023). Eine weitere, aus der islamischen Rechtssprechung stammende, in Iran angewandte Möglichkeit zur Feststellung der Schuld eines Angeklagten, die bei qisas-Vergehen (Mord oder Körperver letzung) zur Anwendung kommen kann, wenn es keine ausreichenden Beweise gibt und ein Richter dennoch Zweifel an der Unschuld des Angeklagten hat, ist das Prinzip des qassameh oder „ geschworenen Eids“. Die Personen, die hierbei einen Eid schwören - eine bestimmte Anzahl an Angehörigen des Opfers - müssen dabei keine direkten Zeugen des Verbrechens gewesen sein (IHRNGO 20.2.2025). Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis Bei Delikten, die im starken Widerspruch zu islamischen Grundsätzen stehen, können jederzeit Körperstrafen ausgesprochen und auch exekutiert werden (ÖB Teheran 11.2021). Im iranischen Strafrecht sind körperliche Strafen wie die Amputation von Fingern, Händen und Füßen oder das Erblinden (ein Auge oder beide) als Vergeltungsmaßnahme vorgesehen. Wie hoch die Zahl der durchgeführten Amputationen ist, kann nicht geschätzt werden, da wenig Berichte dazu an die Öffentlichkeit dringen (AA 15.7.2024). Es wird jedoch von der Durchführung von Amputationen berichtet (AI 29.4.2025; vgl. TST 10.6.2025). Für bestimmte Vergehen wie Alkoholgenuss, Miss achten des Fastengebots oder außerehelichem Geschlechtsverkehr sieht das Strafgesetzbuch Auspeitschung vor. Teilweise besteht die Möglichkeit, diese durch Geldzahlung abzuwenden (AA 15.7.2024). Auf die Anwendung der Vergeltungsstrafen (qisas) der Amputation (z. B. von Fingern bei Diebstahl) und der Blendung können Geschädigte gegen Erhalt eines Abstands geldes (diyah) verzichten. Derzeit ist bei Ehebruch noch die Strafe der Steinigung vorgesehen. Auch auf diese kann vom Geschädigten gegen diyah verzichtet werden. Im Jahr 2002 wurde ein Moratorium für die Verhängung der Steinigungsstrafe erlassen (ÖB Teheran 11.2021), seit 2010 wurde über keine Fälle von Steinigungen mehr berichtet (IHRNGO 20.2.2025). Verlässliche Aussagen zur Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis sind nur eingeschränkt möglich, da diese sich durch Willkür auszeichnet. Mitunter bewusst unbestimmte Formulierun gen von Straftatbeständen und Rechtsfolgen sowie eine unzureichende Kontrolle innerhalb der Justiz ermöglichen ein willkürliches Handeln von Richtern. Zudem agieren Gerichte in po litischen Verfahren nicht unabhängig. Auch willkürliche Verhaftungen kommen häufig vor und führen dazu, dass Häftlinge teils monatelang ohne ein anhängiges Strafverfahren festgehalten 46
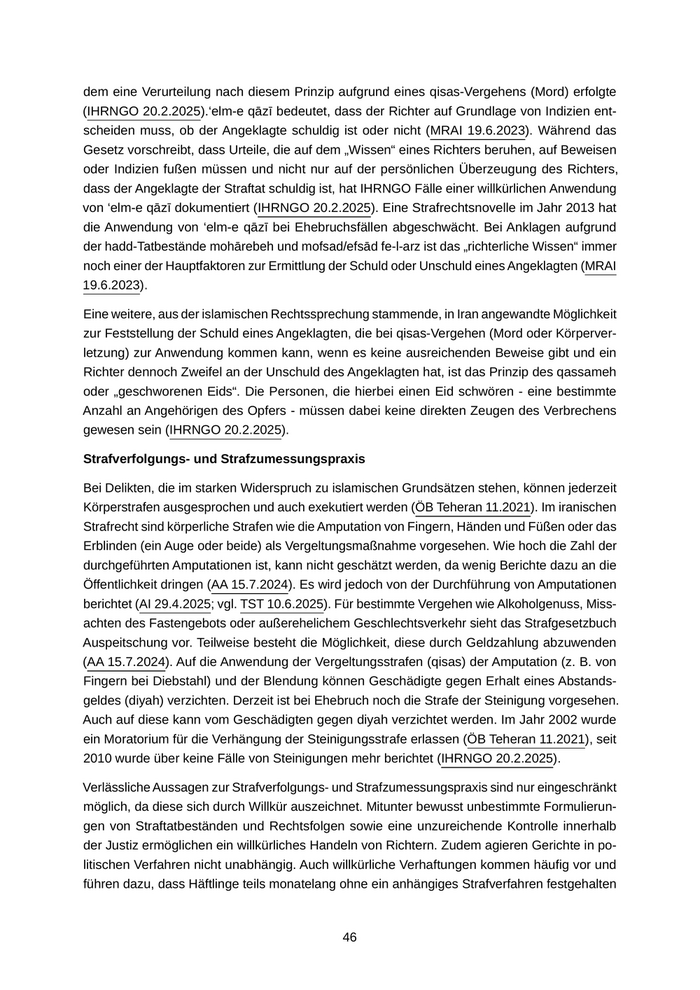
werden. Wohl häufigster Anknüpfungspunkt für Diskriminierung im Bereich der Strafverfolgung
ist die politische Überzeugung. Beschuldigten bzw. Angeklagten werden grundlegende Rechte
vorenthalten, die auch nach iranischem Recht eigentlich garantiert sind. Untersuchungshäft
linge werden bei Verdacht einer Straftat unbefristet ohne Anklage festgehalten. Oft erhalten
Gefangene während der laufenden Ermittlungen keinen rechtlichen Beistand, weil ihnen dieses
Recht bewusst verwehrt wird oder ihnen die finanziellen Mittel fehlen. Insbesondere bei poli
tisch motivierten Verfahren gegen Oppositionelle erfolgt die Anklage oft aufgrund konstruierter
oder vorgeschobener Straftaten. Die Strafen sind in Bezug auf die vorgeworfene Tat oft unver
hältnismäßig hoch, besonders bei Verurteilungen wegen Äußerungen in sozialen Medien oder
Engagement gegen die Hidschab-Pflicht (Kopftuchzwang) (AA 15.7.2024).
Hafterlass ist nach Ableistung der Hälfte der Strafe möglich. Amnestien werden unregelmäßig
vom Revolutionsführer auf Vorschlag des Chefs der Justiz im Zusammenhang mit hohen religiö
sen Feiertagen und dem iranischen Neujahrsfest am 21. März ausgesprochen (AA 15.7.2024).
Quellen
■ AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (15.7.2024): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante
Lage in der Islamischen Republik Iran (Stand: 03. April 2024), https://www.ecoi.net/en/file/local/211
2796/Auswärtiges_Amt,_Bericht_über_die_asyl-_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islami
schen_Republik_Iran,_15.07.2024.pdf, Zugriff 25.7.2024
■ AI - Amnesty International (29.4.2025): Iran: Human rights in Iran: Review of 2024/2025, https:
//www.amnesty.org/en/documents/mde13/9275/2025/en/, Zugriff 21.5.2025
■ BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] (5.2021): Länderreport 35 Iran
Aktuelle Lage vor den Präsidentschaftswahlen: Die hybride Staatsordnung, Strafrecht, Menschen
rechtslage und Ausblick, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationsz
entrum/Laenderreporte/2021/laenderreport-35-Iran.pdf?__blob=publicationFile&v=2#[\{\textooquo
te{}num\textcoquote{}:17,\textooquote{}gen\textcoquote{}:0\},\{\textooquote{}name\textcoquote{}:
\textooquote{}FitH\textcoquote{}\},766], Zugriff 30.3.2023
■ IHRNGO - Iran Human Rights (20.2.2025): Annual Report on the Death Penalty in Iran, https:
//iranhr.net/media/files/Rapport_iran_2024-WEB.pdf, Zugriff 10.3.2025
■ Landinfo/CEDOCA/SEM - Referat für Länderinformationen der Einwanderungsbehörde [Norwegen],
Center for Documentation and Research of the Office of the Commissioner General for Refugees
and Stateless Persons [Belgien], Staatssekretariat für Migration [Schweiz] (12.2021): IRAN Criminal
procedures and documents, https://www.ecoi.net/en/file/local/2064888/joint_coi_report._criminal_pr
ocedures_and_documents_20211206.pdf, Zugriff 17.3.2023
■ MRAI - Menschenrechtsanwältin aus Iran (19.6.2023): Interview, via Videotelefonie
■ ÖB Teheran - Österreichische Botschaft Teheran [Österreich] (11.2021): Asylländerbericht – Islami
sche Republik Iran, https://www.ecoi.net/en/file/local/2064921/IRAN_ÖB-Bericht_2021.pdf, Zugriff
7.2.2023 [Login erforderlich]
■ TST - The Straits Times (10.6.2025): Iran amputates hands of two convicted thieves, https://ww
w.straitstimes.com/world/middle-east/iran-amputates-hands-of-two-convicted-thieves , Zugriff
12.6.2025
5.3 Doppelbestrafung, im Ausland begangene Vergehen, Verurteilung in Abwesenheit
Letzte Änderung 2025-07-16 08:42
Einer vertraulichen Quelle des niederländischen Außenministeriums zufolge hält sich Iran an den
Grundsatz ne bis in idem, wenn es um ta’zir-Strafen geht. Im Falle von hadd- und qisas-Strafen
ist eine doppelte Strafverfolgung dagegen möglich. Auch ist es möglich, dass ein Gericht eine
47
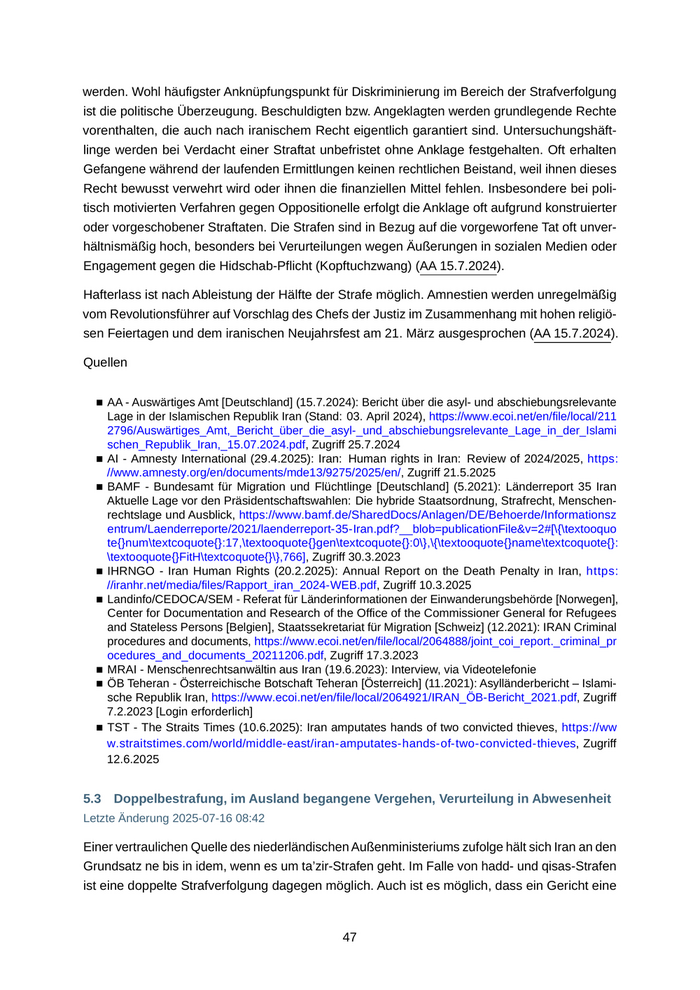
ta’zir-Strafe gegen eine Person verhängt, der Staatsanwalt jedoch im Nachhinein angibt, dass dies ein Fehler war und das Vergehen unter einen hadd-Tatbestand fällt. In diesem Fall kann eine Person zweimal für dieselbe Straftat verurteilt werden, in der Praxis kommt dies jedoch selten vor (MBZ 9.2023). Iranische Staatsbürger unterliegen auch im Ausland der iranischen Gesetzgebung und kön nen nach Artikel 7 des IStGB 2013 für Vergehen, die im Ausland begangen wurden, in Iran belangt werden (Landinfo 9.11.2022). Das Verbot der Doppelbestrafung gilt in diesem Fall nur stark eingeschränkt. Nach dem IStGB werden Iraner oder Ausländer, die bestimmte Straftaten im Ausland begangen haben und in Iran festgenommen werden, nach den jeweils geltenden iranischen Gesetzen bestraft. Auf die Verhängung von islamischen Strafen [Anm.: hadd- und qisas-Strafen] haben bereits ergangene ausländische Gerichtsurteile keinen Einfluss; die Ge richte erlassen eigene Urteile. Insbesondere bei Betäubungsmittelvergehen drohen drastische Strafen (AA 15.7.2024). Ein von Landinfo im Jahr 2021 befragter Rechtsanwalt zeichnete jedoch ein differenzierteres Bild und gab an, dass insbesondere im Ausland begangene Vergehen, wel che die innere und äußere Sicherheit betreffen, in Iran strafrechtlich verfolgt werden. Laut dem Rechtsanwalt werden beispielsweise Alkoholkonsum oder „ unzüchtiges“ Verhalten iranischer Staatsbürger im Ausland in Iran nicht strafrechtlich verfolgt (Landinfo 9.11.2022). In jüngster Vergangenheit sind keine Fälle einer Doppelbestrafung bekannt geworden (AA 15.7.2024). Es kommt in der Praxis vor, dass Personen in Iran in Abwesenheit aufgrund von im Ausland durchgeführten Tätigkeiten verurteilt werden, beispielsweise aufgrund von Veröffentlichungen von kritischen Beiträgen in den sozialen Medien. Mehrere Quellen berichteten von derartigen Fällen von bekannten Aktivisten im Ausland (MBZ 9.2023). Es sind eine Reihe von Fällen be kannt, in denen iranische Staatsangehörige, insbesondere wenn diese als Journalisten oder Blogger eine große Reichweite haben und sich kritisch zu politischen Themen in Iran äußern (Menschenrechtsverletzungen, Korruption und Bereicherung bei Amtsträgerinnen und Amtsträ gern, Frauenrechte, interne Machtkämpfe) in Drittländern entführt wurden, um sie nach Iran zu verbringen, wo sie in (Schau-)Prozessen verurteilt und teils sogar hingerichtet wurden. Auch gibt es glaubhafte Berichte zu Mordanschlägen im Ausland auf diesen Personenkreis (AA 15.7.2024). Quellen ■ AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (15.7.2024): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran (Stand: 03. April 2024), https://www.ecoi.net/en/file/local/211 2796/Auswärtiges_Amt,_Bericht_über_die_asyl-_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islami schen_Republik_Iran,_15.07.2024.pdf, Zugriff 25.7.2024 ■ Landinfo - Referat für Länderinformationen der Einwanderungsbehörde [Norwegen] (9.11.2022): Iran: Internett og sosiale medier, https://www.ecoi.net/en/file/local/2083376/Temanotat-Iran-Interne tt-og-sosiale-medier-09112022.pdf , Zugriff 23.3.2023 ■ MBZ - Außenministerium der Niederlande [Niederlande] (9.2023): Algemeen ambtsbericht Iran, https://www.ecoi.net/en/file/local/2098089/Algemeen ambtsbericht Iran van september 2023.pdf, Zu griff 30.11.2023 48

5.4 Gerichtsdokumente Letzte Änderung 2025-07-17 12:30 Gerichtsdokumente sind nach Auskunft einer ehemals in Iran tätigen Rechtsanwältin größtenteils standardisiert. So muss beispielsweise ein Urteil immer die Aktenzeichen, die Archivnummer und die Zuständigkeit des Gerichts enthalten. Es enthält außerdem eine Zusammenfassung, deren Länge variieren kann. Das Urteil sollte durchgängig auf die relevanten Artikel des anwend baren Gesetzbuchs verweisen - beispielsweise in Strafverfahren auf die relevanten Artikel des Strafgesetzbuchs. Darüber hinaus sollte die im Urteil verwendete Sprache in Bezug auf Inhalt und Wortwahl im gesamten Dokument einheitlich sein (dies bezieht sich auf die Verwendung der Sprache, nicht auf die Formatierung; Unstimmigkeiten in der Schriftart kommen manchmal innerhalb eines Dokuments vor) (MRAI-2 13.6.2025). Papierdokumente, wie z. B. Gerichtsurkunden, Vorladungen und Grundstücksurkunden sind relativ leicht durch betrügerische Mittel zu erhalten (DFAT 24.7.2023) und für Justizunterlagen wie Urteile, Vorladungen etc. kann eine mittelbare Falschbeurkundung wegen der Korruption im Justizsystem nicht ausgeschlossen werden. Sofern die Dokumente in der Justizdatenbank SANA hinterlegt sind, kann von deren Echtheit ausgegangen werden (AA 15.7.2024). Sowohl die von iranischen Behörden als auch von der afghanischen Botschaft in Iran ausge stellten Dokumente bestätigen unrichtige Angaben. Eine Überprüfung ist seitens der österrei chischen Botschaft nicht möglich. Die Überprüfung von Haftbefehlen kann von der Botschaft aufgrund von Datenschutz nicht durchgeführt werden (ÖB Teheran 11.2021). SANA-System/Justizdatenbank Adliran Durch die sukzessive Digitalisierung des Justizsystems können seit Ende 2016 Justizdokumente über das sog. SANA-System [bzw. in der Datenbank Adliran] abgerufen werden (AA 15.7.2024). Das SANA-System ist eine elektronische Rechtsdatenbank der Justiz, die zur Registrierung und Verfolgung von Fällen dient. Über das SANA-System können Anwälte und Mandaten auf die Dokumente eines Falles zugreifen (MBZ 9.2023). Seit 2019 werden Justizdokumente in allen Provinzen in der Regel fast ausschließlich über diese Datenbank kommuniziert (vgl. Art. 175 iranische StPO in der Fassung von 2013/14) (AA 15.7.2024). Das SANA-System ist verpflich tend und inzwischen werden beinahe alle Gerichtsfälle im SANA-System bearbeitet (MRAI-2 13.6.2025). Wenn eine Person vor Gericht erscheinen muss, wird sie per SMS benachrichtigt, dass ein Brief im SANA-System vorhanden ist. Sollte sie kein SANA-Konto haben, wird eine Benachrichtigung in Papierform ausgestellt. Darin wird darauf hingewiesen, dass sich der Adressat über das SA NA-System für die weiteren Schritte registrieren muss (MBZ 9.2023). Die Registrierung erfolgt durch persönliche Vorsprache oder eine Art Video-Identitätsfeststellungsverfahren. Ferner sind v. a. die Kart-e melli-Nummer und eine iranische Mobilfunknummer erforderlich, an die ein tem poräres Passwort versendet wird (AA 15.7.2024). Auch Dritte können auf die Justizdokumente einer Person zugreifen, wenn sie die zehnstellige „ nationale Nummer“ der Person (den Benut zernamen) und das sechsstellige temporäre Passwort haben, das per SMS zugesandt wird. 49
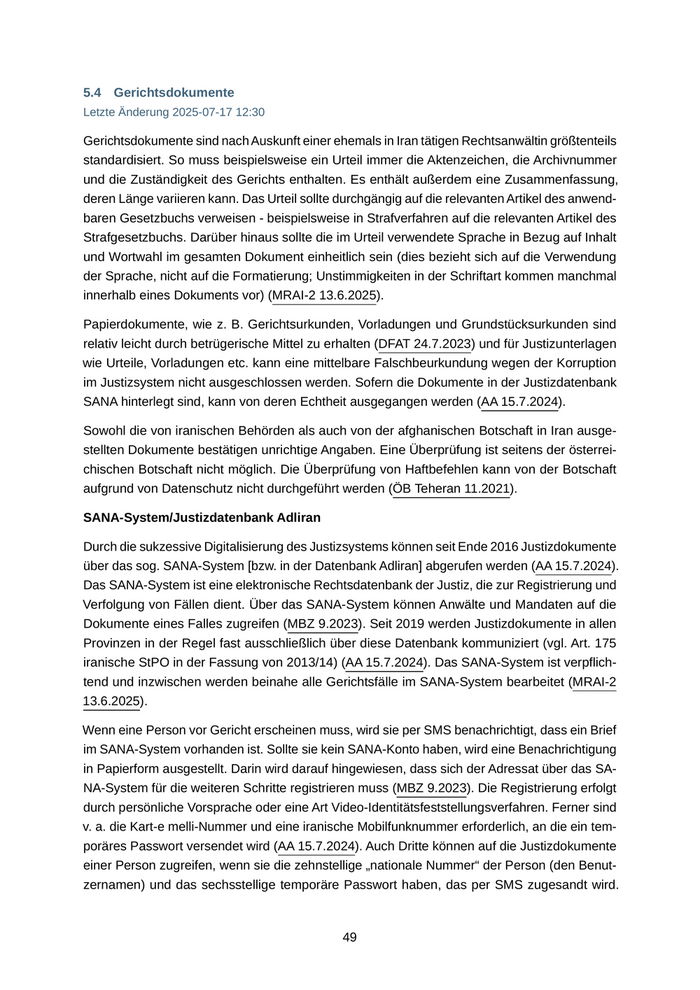
Mit den Zugangsdaten kann jeder, einschließlich Familienmitglieder und Rechtsvertreter von Beschuldigten, auf die in der Datenbank gespeicherten Informationen zugreifen und Dokumente ausdrucken (Landinfo/CEDOCA/SEM 12.2021; vgl. MBZ 9.2023). Wer über ein SANA-Konto verfügt [d. h. sich schon im SANA-System registriert hat], kann auch aus dem Ausland darauf zugreifen. In einigen Fällen muss jedoch möglicherweise ein VPN ver wendet werden, um von außerhalb des Landes auf das Portal zugreifen zu können. Für Iraner, die außerhalb des Landes leben, wurde eine neue Website (https://international-sana.itsaaz .com/) eingerichtet, um ihnen den Zugang zu erleichtern. Sie können nun international aner kannte Zahlungskarten und ihre ausländische Telefonnummer verwenden (MRAI-2 13.6.2025). Im Ausland lebende Iraner berichten jedoch, dass die Registrierung von außerhalb des Landes nicht einfach ist. Um beispielsweise ein Konto zu eröffnen, benötigen sie einen neuen „ smarten“ Personalausweis (MRAI-2 13.6.2025; vgl. Migrationsverket 28.10.2024), den sie von Konsula ten im Ausland [i.d.R.] nicht erhalten können (MRAI-2 13.6.2025), wobei die Behörden im Jahr 2022 ankündigten, dass sich Auslandsiraner nun für „ smarte“ Personalausweise beim iranischen Konsulat in Wien registrieren könnten (TEHT 10.4.2022). Nur wenige iranische Konsulate im Ausland unterstützen ihre Bürger beim Zugang zum SANA-System. Das Konsulat in Amsterdam bietet diesen Service beispielsweise an. Es gibt auch Websites, die die Einrichtung eines SA NA-Kontos gegen eine Gebühr anbieten, allerdings hat die iranische Botschaft im Vereinigten Königreich beispielsweise von deren Nutzung abgeraten (MRAI-2 13.6.2025). Manche Dokumente können nicht im SANA-System abgerufen werden (z. B. Sitzungsproto kolle oder die meisten Akten von Revolutionsgerichten) (MRAI-2 13.6.2025). Es ist unklar, auf welche Informationen Nutzer im SANA-System konkret zugreifen können und inwieweit dies von Fall zu Fall variiert. Im Allgemeinen ist die Nutzung des SANA-Portals bei den Revoluti onsgerichten stärker eingeschränkt als bei anderen Gerichten (Migrationsverket 28.10.2024). Die Revolutionsgerichte laden lediglich Benachrichtigungen über den Verhandlungstermin eines Gerichtsprozesses sowie darüber, dass ein Gerichtsurteil gefällt wurde, in das SANA-System hoch (MRAI-2 13.6.2025). Militärgerichte, die Straftaten von Angehörigen der Streitkräfte bei der Dienstausübung verhandeln, sind gesetzlich dazu verpflichtet, Dokumente zu Urteilen im SANA- System bereitzustellen. Laut einer vom niederländischen Außenministerium befragten Quelle hängt es jedoch vom jeweiligen Fall ab, ob ein Urteil eines Militärgerichts im SANA-System sichtbar ist. Bei sensiblen Fällen können die Gerichte die Bediensteten auffordern, persönlich zur Urteilseinsicht zu erscheinen (MBZ 9.2023). Antragsteller können den Asylbehörden nur dann Dokumente aus dem SANA-System vorlegen, wenn sie im SANA-System registriert sind. In sicherheitsbezogenen Fällen werden Vorladungen möglicherweise nur telefonisch erteilt. Ein Gerichtsverfahren kann mit einem Anruf oder einer SMS von Sicherheitsbeamten oder manchmal sogar mit einem Klopfen an der Tür beginnen. In vielen Fällen verlassen Personen mit rechtlichen Problemen Iran danach, d. h. während der Ermittlungsphase, und oft in Eile, was bedeutet, dass sie möglicherweise nicht über viele - oder gar keine - offiziellen Dokumente verfügen, um ihren Rechtsfall zu belegen. Diese Perso nen verlassen Iran möglicherweise aus Angst vor Verfolgung, einschließlich langer Haftstrafen, nachdem sie erfahren haben, dass gegen sie ermittelt wird, da viele Handlungen in Iran unter 50