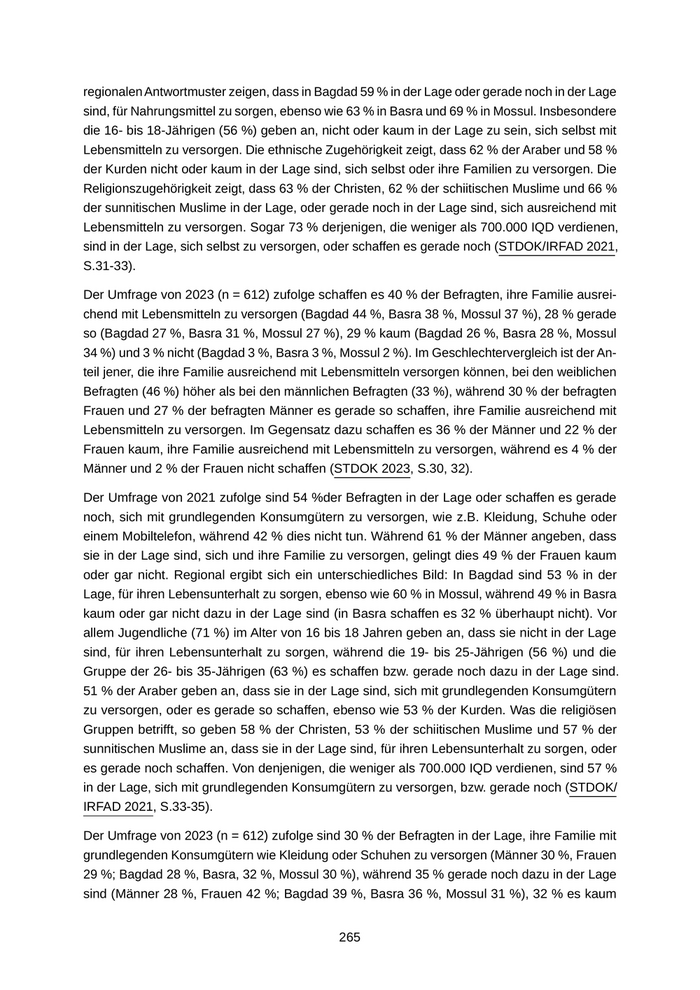2025-09-09-coi-cms-laenderinformationen-irak-version-8-99ad
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Länderinformationsblätter“
ihre Bewegungsfreiheit ein, einschließlich ihrer Möglichkeiten zur Inanspruchnahme medizini scher Versorgung, wegen der Gefahr von Verhaftungen oder der Unmöglichkeit, in das Lager zurückzukehren, in dem sie zuvor lebten (USDOS 30.3.2021). Im Oktober 2020 kündigte der Minister für Vertreibung und Migration einen Drei-Phasen-Plan zur Schließung aller Binnenvertriebenenlager des Landes an und begann sofort mit einer Rei he von plötzlichen Lagerschließungen in den Gouvernements Anbar, Bagdad, Diyala, Kerbala, Kirkuk und Ninewa. Die Schließungen waren nicht mit den zuständigen lokalen Behörden oder humanitären Akteuren koordiniert und nicht alle betroffenen IDPs waren in der Lage oder bereit, an ihren Herkunftsort zurückzukehren (USDOS 30.3.2021). Nach der Schließung von 16 Ver triebenenlagern in Gebieten außerhalb der KRI durch die Regierung Ende 2020 konnten nach Berichten internationaler NGOs nur etwa 41 % derjenigen, die die Lager verließen, an ihren vorherigen Wohnsitz zurückkehren (USDOS 12.4.2022). Diese Schließungen zwangen viele IDPs zur Rückkehr in zerstörte Häuser und Dörfer ohne Grundversorgung (UNHCR 27.5.2021). Während einige IDPs nach den Lagerschließungen in ihre Herkunftsgebiete zurückkehren konn ten, war eine beträchtliche Anzahl von ihnen nicht dazu in der Lage (UNHCR 27.5.2021, S.5-6), sondern war mit neuerlicher Vertreibung konfrontiert (UNHCR 27.5.2021, S.5-6; vgl. USDOS 12.4.2022). Im Zusammenhang mit den Lagerschließungen Ende 2020 gewährten die Behörden vielen der betroffenen Personen eine Sicherheitsfreigabe und stellten ihnen neue zivile Dokumente aus. Da sie die Familien jedoch in einigen Fällen nur 24 Stunden vorher darüber informierten, dass sie die Lager, in denen sie jahrelang gelebt hatten, verlassen mussten, wurden einige von ih nen faktisch ihres Zugangs zu Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung beraubt und obdachlos gemacht (HRW 13.1.2021). Mindestens 34.801 Vertriebenen war es nicht möglich, sicher nach Hause zurückkehren. Sie erhielten keine andere sichere Unterkunft und hatten keinen Zugang zu erschwinglichen Dienstleistungen. Bei vielen handelte es sich um von Frauen geführte Haushalte, die durch die Kämpfe zwischen dem IS und den irakischen Sicherheits kräften zwischen 2014 und 2017 vertrieben wurden. Viele dieser Familien werden als IS-nahe eingestuft (HRW 13.1.2022). Während 830.000 (71 %) Binnenvertriebene in gemieteten Häusern oder Wohnungen leben (Stand September 2022), leben 179.000 (15 %) in 26 offiziellen Lagern im Irak, 3.000 weni ger als im September 2021. Das Camp Coordination and Camp Management Cluster (CCCM) erleichtert die Koordinierung der Hilfe für Binnenvertriebene, die in offiziellen Lagern und an informellen Standorten im Irak leben. Im Juli 2022 gab das Humanitäre Länderteam der Verein ten Nationen bekannt, dass alle Cluster im Irak aufgelöst werden. Während die Konsolidierung der Lager weiterläuft, werden die Zuständigkeiten des CCCM vom UNHCR und der Internatio nalen Organisation für Migration (IOM) übernommen. Vor diesem Hintergrund unterstützt der Mechanismus für dauerhafte Lösungen unter dem gemeinsamen Vorsitz von IOM und UNDP Binnenvertriebene dabei, sich in die Aufnahmegemeinschaften zu integrieren, in ihre Herkunfts gebiete zurückzukehren oder sich anderswo niederzulassen (REACH/CCCM 23.11.2022, S.1). 256
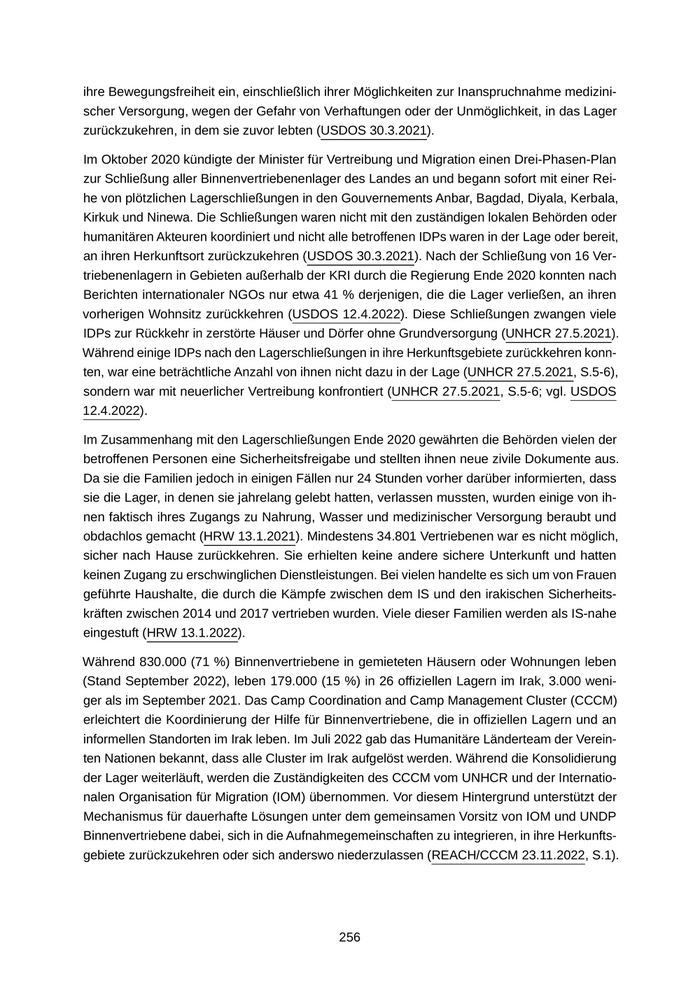
Die KRG verwaltet 25 der 26 verbliebenen IDP-Lager im Land (REACH/CCCM 23.11.2022, S.2; vgl. USDOS 20.3.2023) und hat sich verpflichtet, diese nicht zu schließen, bevor die Vertriebe nen nicht freiwillig in ihr Herkunftsgebiet zurückgekehrt sind (USDOS 20.3.2023). 15 IDP-Lager, von denen sich drei in Ninewa [Anm.: in den umstrittenen Gebieten] befinden, werden vom Gou vernement Dohuk verwaltet, sechs Lager, von denen drei in Ninewa liegen, vom Gouvernement Erbil und vier Lager, von denen eines in Diyala liegt, durch das Gouvernement Sulaymaniyah. Ein offizielles IDP-Lager im Gouvernement Ninewa wird auch von diesem verwaltet (REACH/ CCCM 23.11.2022, S.2). Im Rahmen einer Datenerhebung im Juli 2022 wurden 2.342 in Lagern lebende IDP-Haushalte in den Gouvernements Erbil, Dohuk, Sulaymaniyah und Ninewa zum Thema einer möglichen Rückkehr in ihre Herkunfstgebiete interviewt. 1.407 IDP-Haushalte wurden in Dohuk befragt, 547 in Erbil, 293 in Sulaymaniyah und 95 in Ninewa. In Duhok gab die überwiegende Mehrheit (94 %) der befragten IDP-Haushalte beispielsweise an, binnen der nächsten zwölf Monate nicht in ihre Herkunftsgebiete zurückkehren zu wollen. Die am häufigsten genannten Gründe, nicht in die Herkunftsgebiete zurückzukehren, sind: Mangel an Sicherheitskräften (52 %), zerstörte/be schädigte Unterkünfte (42 %), keine Grundversorgung im Herkunftsgebiet (31 %), mangelnde Sicherheit für Frauen und Mädchen (30 %) sowie Angst bzw. Trauma im Zusammenhang mit dem Herkunftsgebiet (29 %). Weitere hinderliche Gründe, die von IDPs in Lagern der übrigen drei Gouvernements genannt wurden sind fehlende finanzielle Mittel für eine Rückkehr sowie fehlende Möglichkeiten den Lebensunterhalt zu bestreiten. Fast drei Viertel (71%) der Befragten in Dohuk gaben jedoch an, eines Tages in ihre Herkunftsgebiete zurückkehren zu wollen. In den Lagern unter Verwaltung der Gouvernements Erbil und Sulaymaniyah lag der Anteil der befrag ten Haushalte, welche angaben, innerhalb des nächsten Jahres im Lager bleiben zu wollen, in das sie vertrieben wurden, auf einem ähnlichen Niveau (zwischen 88 und 97 %). In einem vom Gouvernement Ninewa verwalteten Lager gaben dagegen nur 22 % der befragten Haushalte an, in den nächsten zwölf Monaten an ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort bleiben zu wollen. 25 % gaben an, in ihren Herkunftsort zurückkehren zu wollen und beinahe die Hälfte der Befragten hat diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen (REACH/CCCM 23.11.2022). Ausländische Flüchtlinge Der Irak ist nicht Vertragsstaat der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 bzw. dessen Zusatz protokoll von 1967 (GFK o.D.). Das irakische Gesetz sieht jedoch die Gewährung von Asyl vor, und die Regierung hat ein System zum Schutz von Flüchtlingen eingerichtet (USDOS 20.3.2023). Der Status ausländischer Flüchtlinge wird durch das Gesetz über politische Flüchtlinge, Nr. 51 (1971) geregelt. Der Entwurf einer Novellierung des Gesetzes wurde bislang nicht verabschiedet. Die Flüchtlinge befinden sich überwiegend in und um Bagdad sowie unmittelbar im Grenzbereich zu Syrien und Jordanien (AA 28.10.2022, S.22). Die Regierung arbeitet im Allgemeinen mit dem UNHCR, IOM und anderen humanitären Organisationen zusammen, um Flüchtlingen im Land Schutz und Unterstützung zu bieten (USDOS 20.3.2023). Der Irak beherbergt etwa 280.000 Flüchtlinge und Asylbewerber, von denen über 80 % in der KRI leben (UNHCR 31.7.2023). 257
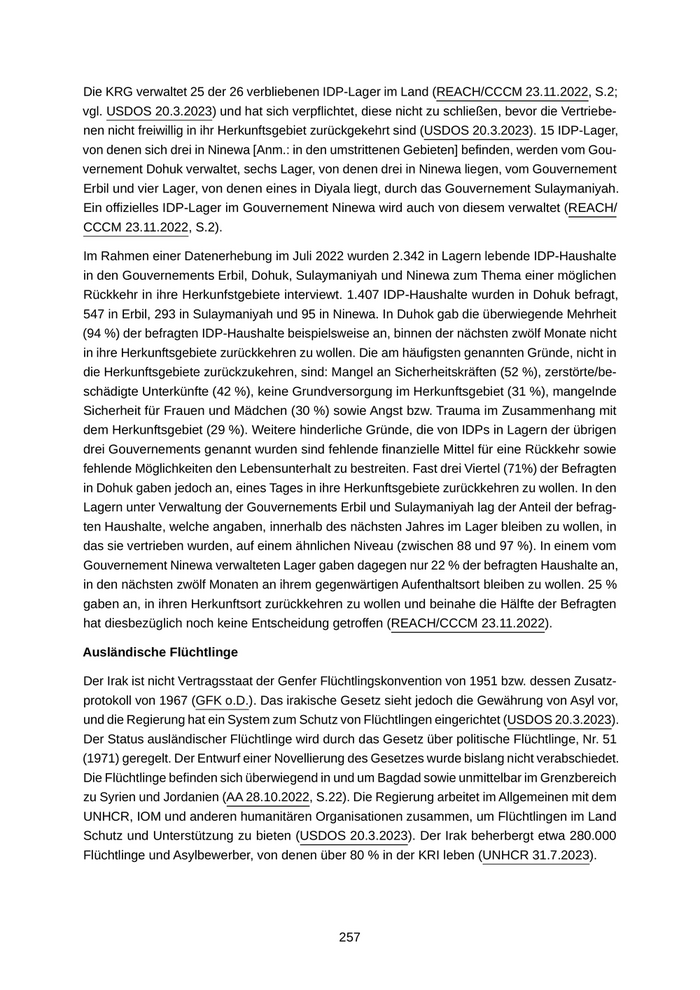
Nach Angaben des „ Gemeinsamen Krisenkoordinationszentrums“ (Joint Crisis Coordination Center, JCC) sind 253.960syrische, 8.890 türkische, 9.982 iranische und 787 palästinensische Flüchtlinge sowie 628 Personen anderer Nationalitäten in der KRI aufhältig (USDOS 15.5.2023). Mehr als 230.000 der syrischen Flüchtlinge sind Kurden (UNHCR 31.7.2023). Flüchtlinge und Asylwerber sind gesetzlich berechtigt, in der Privatwirtschaft zu arbeiten (USDOS 20.3.2023). Quellen ■ AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (28.10.2022): Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak (Stand: Oktober 2022), https://www.ecoi.net/e n/file/local/2082728/Auswärtiges_Amt,_Bericht_über_die_asyl-_und_abschiebungsrelevante_ Lage_in_der_Republik_Irak_(Stand_Oktober_2022),_28.10.2022.pdf , Zugriff 23.3.2023 [Login erforderlich] ■ DFAT - Department of Foreign Affairs and Trade [Australien] (16.1.2023): DFAT Country Information Report Iraq, https://www.ecoi.net/en/file/local/2085737/country-information-report-iraq.pdf , Zugriff 2.2.2023 ■ FH - Freedom House (2023): Freedom in the World 2023 - Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument /2090187.html, Zugriff 7.7.2023 ■ FH - Freedom House (24.2.2022): Freedom in the World 2022 - Iraq, https://www.ecoi.net/de/doku ment/2068634.html, Zugriff 11.7.2023 ■ FH - Freedom House (3.3.2021a): Freedom in the World 2021 – Iraq, https://www.ecoi.net/en/docu ment/2046520.html, Zugriff 11.7.2023 ■ GFK - Genfer Flüchtlingskonvention (o.D.): Vertragsstaaten der Genfer Flüchtlingskonvention, https: //www.fluechtlingskonvention.de/vertragsstaaten-der-genfer-fluechtlingskonvention-3274/ , Zugriff 28.8.2023 ■ HRW - Human Rights Watch (13.1.2022): World Report 2022 - Iraq, https://www.ecoi.net/en/docu ment/2066472.html, Zugriff 13.7.2023 ■ HRW - Human Rights Watch (3.6.2021): Inadequate Plans for Camp Closures, https://www.ecoi.net /en/document/2053207.html, Zugriff 3.6.2021 ■ HRW - Human Rights Watch (13.1.2021): World Report 2021 - Iraq, https://www.ecoi.net/de/doku ment/2043505.html, Zugriff 16.8.2023 ■ IDMC - Internal Displacement Monitoring Centre (24.5.2023): Country Profile Iraq, https://www.inte rnal-displacement.org/countries/iraq#displacement-data, Zugriff 25.8.2023 ■ IOM - International Organization for Migration (6.2023): DTM, Displacement Tracking Matrix, Iraq Master List Report 129, Date Collection Period: January - April 2023, https://iraqdtm.iom.int/images /MasterList/20236153417216_DTM_129_Report_January_April_2023.pdf, Zugriff 25.8.2023 ■ REACH/CCCM - REACH Initiative, Camp Coordination and Camp Management (23.11.2022): Move ment Intentions Survey; IDP Households in Formal Camps - July 2022; Governorate of Displacement; Duhok, Erbil, Al-Sulaymanyiah, Ninewa, https://reliefweb.int/attachments/f997624e-22a8-4faa-b ef4-7e7b89e9cdcf/REACH_IRQ_Factsheet_MovementIntentionsGoD_Nov2022_final.pdf , Zugriff 24.8.2023 ■ UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees (31.7.2023): Operational Data Portal Country View, https://data.unhcr.org/en/country/irq, Zugriff 28.8.2023 ■ UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees (27.5.2021): Returning Iraqis face dire conditions following camp closures, https://www.ecoi.net/en/document/2052458.html , Zugriff 1.6.2021 ■ UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees (11.1.2021): Ability of Persons Originating from Formerly ISIS-Held or Conflict-Affected Areas to Legally Access and Remain in Proposed Areas of Internal Relocation, https://www.ecoi.net/en/file/local/2043432/5ffc243b4.pdf, Zugriff 24.8.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (15.5.2023): 2022 Report on International Reli gious Freedom: Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2091863.html, Zugriff 12.7.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (20.3.2023): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2089064.html, Zugriff 11.7.2023 258
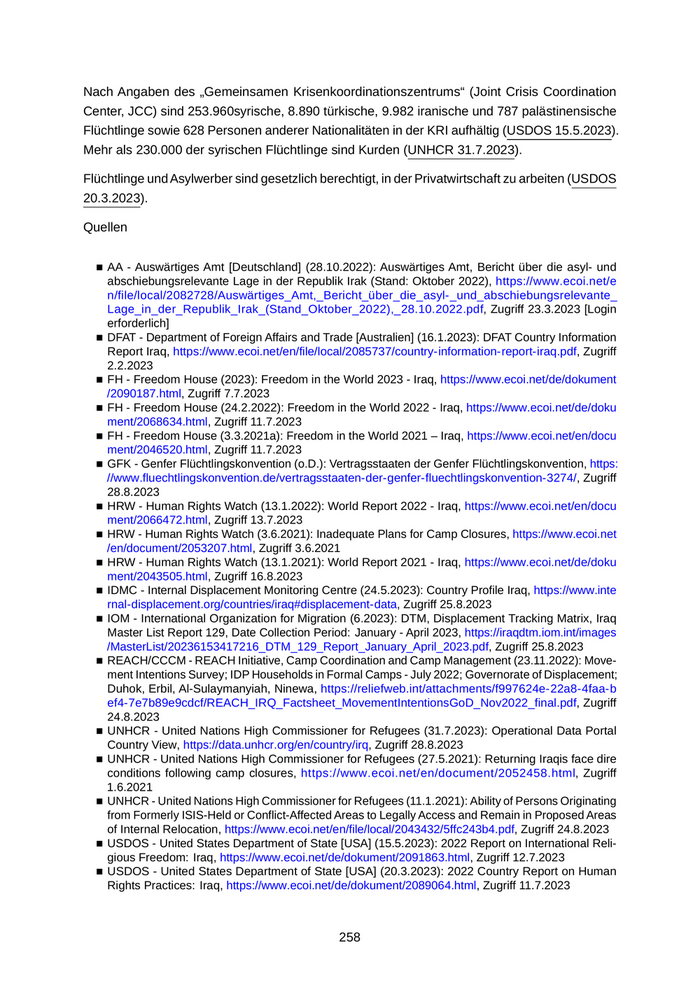
■ USDOS - United States Department of State [USA] (12.4.2022): 2021 Country Report on Human Rights Practices: Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2071125.html, Zugriff 24.8.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (30.3.2021): 2020 Country Report on Human Rights Practices: Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2048100.html, Zugriff 11.7.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2026340.html, Zugriff 21.8.2023 22 Grundversorgung und Wirtschaft Letzte Änderung 2024-03-28 11:01 Der Staat kann die Grundversorgung der Bürger nicht kontinuierlich und in allen Landesteilen gewährleisten (AA 28.10.2022, S.22). Einige Städte und Siedlungen sind weitgehend zerstört (AA 25.10.2021, S.24). Die Stabilisierungsbemühungen und der Wiederaufbau durch die ira kische Regierung werden intensiv vom United Nations Development Programme (UNDP) und internationalen Gebern unterstützt (AA 28.10.2022, S.22). Der Zugang zu vielen Rechten und grundlegenden Dienstleistungen ist mit der Registrierung des Wohnorts und der ausgestellten Wohnkarte verknüpft. Dazu gehören unter anderem der Erhalt bzw. die Erneuerung von Ausweispapieren, der Abschluss formeller Mietverträge, der Erwerb von Eigentum, der Zugang zu Beschäftigung und der Zugang zu Gesundheitsversor gung, Bildung und Lebensmittelrationen über das Public Distribution System (PDS) (UNHCR 11.2022, S.6-7). Früher hatte die gesamte irakische Bevölkerung Anspruch auf das PDS, aber seit 2016 haben Personen mit einem Einkommen von über 1.100 USD und Regierungsange stellte, ab dem Dienstgrad eines Generaldirektors, keinen PDS-Zugang mehr. Der PDS-Zugang umfasst zehn Produkte, die 100 % des täglichen Mindestkalorienbedarfs abdecken: Weizen mehl (9 kg/Karte/Person/Monat), Reis (3 kg), Zucker (2 kg), Pflanzenöl (1 l) und Kindermilch (3 Packungen zu je 450 g). PDS sollte monatlich ausgehändigt werden, jedoch wurde die Vertei lung aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs und des Konflikts im Land unterbrochen und ab 2017 vierteljährlich zugeteilt (SP-UNDP 8.11.2023). Haushaltsvorstände, die bereits eine Wohnungskarte auf ihren Namen für einen beliebigen Ort im Irak besitzen und ihren Wohnort wechseln möchten, müssen ihre Wohnungskarte auf den neuen Wohnort übertragen. Haushaltsvorstände, die keine Wohnungskarte auf ihren Namen haben, weil sie z.B. noch in den Unterlagen ihrer Familie aufgeführt sind, müssen eine neue Wohnungskarte für den Ort beantragen, an dem sie sich niederlassen möchten. Für beide Verfahren (Übertragung oder Ausstellung der Wohnungskarte) muss der Haushaltsvorstand eine Reihe von administrativen und dokumentarischen Anforderungen erfüllen. Diese sind in den Anweisungen des Innenministeriums zur Wohnungskarte (2018) dargelegt. In der Praxis kann die Umsetzung dieser Anweisungen variieren (UNHCR 11.2022, S.7). In manchen Fällen ist zwar eine Übertragung der Wohnkarte möglich, aber der Zugang zum PDS bleibt am Herkunftsort bestehen [siehe: Einreise und Einwanderung in die Kurdistan Region Irak (KRI)]. Nach Angaben der Weltbank (2018) leben 70 % der Iraker in Städten. Die Lebensbedingungen von einem großen Teil der städtischen Bevölkerung ist prekär, ohne ausreichenden Zugang zu grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen. Die über Jahrzehnte durch internationale Isolation und Krieg vernachlässigte Infrastruktur ist sanierungsbedürftig (AA 28.10.2022, S.22). 259
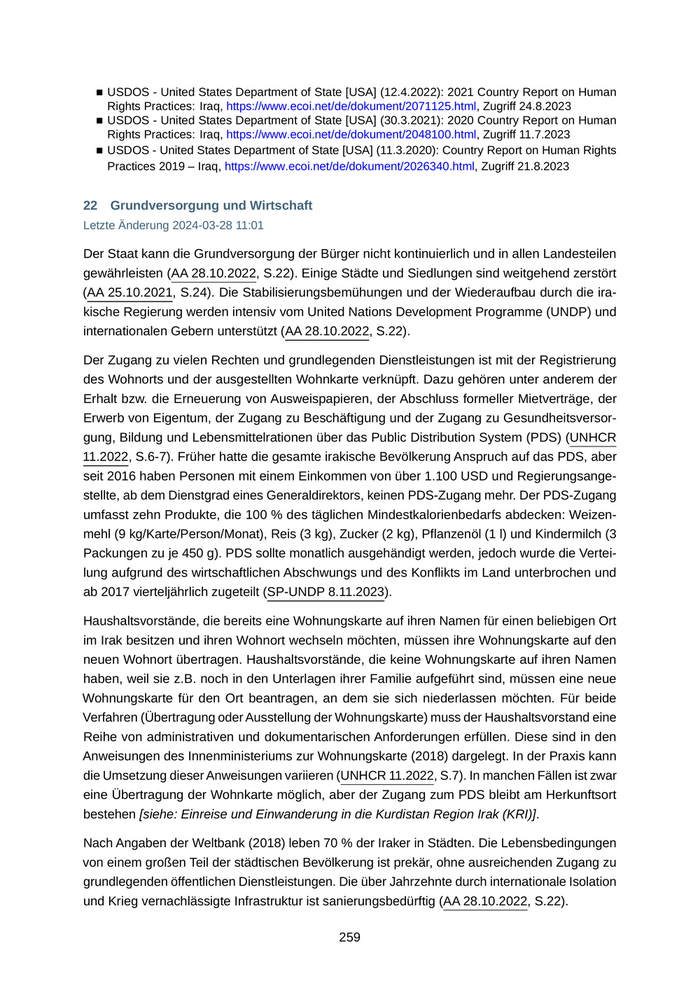
Wirtschaftslage Der Irak ist eines der am stärksten vom Öl abhängigen Länder der Welt. In den letzten zehn Jahren machten die Öleinnahmen mehr als 99% der Ausfuhren, 85 % des Staatshaushalts (WB 1.6.2022; vgl. DFAT 16.1.2023, S.8) und 42 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Die se übermäßige Abhängigkeit vom Öl setzt das Land makro-ökonomischer Volatilität aus (WB 1.6.2022). Der Ölsektor erwirtschaftet rund 90 % der Staatseinnahmen. Abseits des Ölsektors besitzt der Irak kaum eigene Industrie. Hauptarbeitgeber ist der Staat (AA 28.10.2022, S.22). Ein stärkerer Rückgang der Ölpreise oder längere OPEC+-Kürzungen könnten die Haushalts- und Außenhandelsbilanz belasten (IMF 3.3.2024). Im Jahr 2020 sinkende Ölpreise und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben sich negativ auf die Wirtschaftsentwicklung niedergeschlagen, die wirtschaftlichen Probleme des Irak verstärkt und zwei Jahre der stetigen Erholung zunichtegemacht (WB 5.4.2021; vgl. DFAT 16.1.2023, S.8). Inzwischen hat sich die irakische Wirtschaft, gestützt auf den Öl-Sektor, von der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Rezession des Jahres 2020 erholt. Die übrigen Sektoren stagnieren jedoch nach wie vor. Reformen sind notwendig, um das Wachstum auch im Privatsektor anzukurbeln (WB 31.7.2023). Steigende Ölpreise im Jahr 2022 ließen die Öleinnah men auf den höchsten Stand seit 50 Jahren steigen (DFAT 16.1.2023, S.8). Die Trendwende auf den Ölmärkten hat die mittelfristigen Wirtschaftsaussichten des Irak verbessert (WB 1.6.2022). Das BIP des Jahres 2022 ist auf 7,0 % gestiegen, im ersten Quartal 2023 jedoch auf 2,6 % im Jahresvergleich gesunken (WB 31.7.2023). Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat einen Rückgang des Wachstums des irakischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) aufgrund von Ölförderkürzungen durch die OPEC+ und der Un terbrechung der Pipeline mit der Türkei vorausgesagt. Der IWF stellte jedoch fest, dass sich die Wirtschaftstätigkeit des Irak trotz dieser Herausforderungen erholt. Der Fonds geht davon aus, dass das BIP im Jahr 2024 (ohne dem Öl-Sektor) dank der Ausweitung der öffentlichen Finanzen im Rahmen des dreijährigen Haushaltsgesetzes wachsen wird (ECOME 20.12.2023). Das Wachstum im Nicht-Öl-Sektor hat sich 2023 stark erholt, während die Inflation zurück gegangen ist. Gestützt durch höhere öffentliche Ausgaben und eine solide landwirtschaftliche Produktion dürfte das reale BIP außerhalb des Ölsektors 2023 um 6 % gewachsen sein, nach dem es 2022 zum Stillstand gekommen war. Die Gesamtinflation ging von einem Höchststand von 7,5 % im Januar 2023 auf 4 % zum Jahresende zurück, was auf die niedrigeren interna tionalen Lebensmittel- und Energiepreise und die Auswirkungen der Währungsaufwertung vom Februar 2023 zurückzuführen ist. Die Leistungsbilanz wird voraussichtlich einen Überschuss von 2,6% des BIP aufweisen, und die internationalen Reserven stiegen auf 112 Milliarden US-Dollar (IMF 3.3.2024). Der kürzlich verabschiedete irakische Haushalt 2023-2025 signalisiert einen deutlich expansiven fiskalischen Kurs, der zu einer raschen Erschöpfung der Ölreserven und erneutem fiskalischen Druck führen könnte. Außerdem werden langjährige Strukturreformen, die für die Entwicklung einer dynamischen und nachhaltigen Wirtschaft erforderlich sind, aufgeschoben (WB 31.7.2023). 260
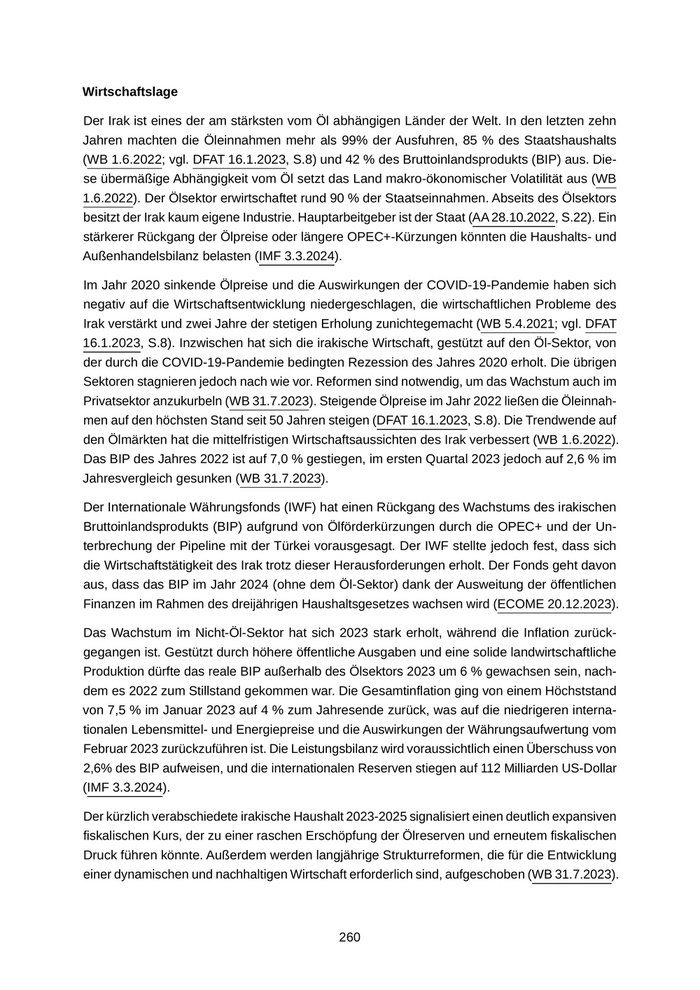
Das Wirtschaftswachstum wird sich den Projektionen zufolge bei einer expansiven Finanzpolitik fortsetzen. Das Gesamtwachstum ist prognostiziert, sich im Jahr 2024 erholen (IMF 3.3.2024). Etwa 18 % der Arbeitskräfte sind in der Landwirtschaft tätig (DFAT 16.1.2023, S.8). Ein wichtiger Faktor für die Landwirtschaft, vor allem im Süden des Irak, sind die Umweltzerstörung und der Klimawandel (Altai 14.6.2021). Die geringe Niederschlagsmenge hat zu weitreichenden Problemen bei der Lebensmittel- und Wassersicherheit geführt. Die Produktion von wichtigen Feldfrüchten wie Weizen und Gerste ging bis 2021 um 70 bis 90 % zurück (DFAT 16.1.2023, S.8). Die abnehmenden Niederschlagsmengen, höheren Temperaturen sowie flussaufwärts gelegene Staudämme in der Türkei und in Iran haben den Wasserfluss im Euphrat- und Tigris-Becken verringert, in dem die Gouvernements Basra, Dhi Qar und Missan liegen. Die Verringerung des Wasserflusses hat Auswirkungen auf den Zugang zu Wasser, der für den Anbau von Pflanzen entscheidend ist (Altai 14.6.2021). Die Arbeitslosigkeit im Irak ist hoch, und die Erwerbsbeteiligung gehört zu den niedrigsten der Welt (DFAT 16.1.2023, S.8). Im Januar 2021 lag die Arbeitslosenquote im Irak kurzfristig um mehr als 10 % über dem Niveau von 12,7 % vor der COVID-19-Pandemie (WB 1.6.2022). Für das Jahr 2021 wird die Arbeitslosenquote auf 16,5 % geschätzt (ILO 5.7.2022; vgl. ILO/CSO/ KRSO 2022, S.11). Dabei ist die Arbeitslosenquote in städtischen Gebieten mit 17,6 % höher als in ländlichen Gebieten mit 13,3 % (ILO 5.7.2022; vgl. ILO/CSO/KRSO 2022, S.12). Die Arbeitslosenquote stieg von 15,3% im Jahr 2022 auf 15,6% im Jahr 2023 (Stand Dezember) (TE 2024). Frauen und junge Menschen sind besonders häufig arbeitslos (DFAT 16.1.2023, S.8). Die Ar beitslosenquote der Frauen ist mit 28,2 % (ILO 5.7.2022; vgl. ILO/CSO/KRSO 2022, S.12) bzw. 29,7 % (DFAT 17.8.2020, S.13) etwa doppelt so hoch wie die der Männer (14,7 %), und die Jugendarbeitslosenquote (35,8 %) ist mehr als dreimal so hoch wie die Arbeitslosenquote der Erwachsenen (11,2 %) (ILO 5.7.2022; vgl. ILO/CSO/KRSO 2022, S.12). Die Arbeitslosigkeit unter Vertriebenen, Rückkehrern, arbeitssuchenden Frauen, Selbstständi gen aus der Zeit vor der Pandemie und informell Beschäftigten ist weiterhin hoch (WB 1.6.2022). Besonders hoch ist die Arbeitslosigkeit bei IDPs, die in Lagern leben. 29 % der betroffenen Haushalte gaben an, dass mindestens ein Mitglied arbeitslos ist und aktiv nach Arbeit sucht. Bei IDPs, die außerhalb von Lagern leben, sind es 22 %, und 18 % bei Rückkehrern (UNOCHA 2.2021, S.28). Die Arbeitsmarktbeteiligung im Irak war mit 48,7 % im Jahr 2019 bereits vor der Ausbreitung des COVID-19-Virus eine der niedrigsten der Welt (IOM 18.6.2021, S.5; vgl. ILO 2021). Der wirtschaftliche Abschwung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie hat die Beschäfti gungsmöglichkeiten deutlich reduziert und die Löhne gesenkt (IOM 18.6.2021, S.5). Einer Umfrage von 2021 zufolge liegt die Erwerbsquote der Personen, die auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind, also entweder beschäftigt oder arbeitslos [Anm.: und arbeitssuchend], im Jahr 2021 bei 39,5 % (ILO 5.7.2022). Die Erwerbsquote ist in städtischen Gebieten (40,3 %) höher als in ländlichen Gebieten (37,3 %) (ILO 5.7.2022; vgl. ILO/CSO/KRSO 2022, S.12). Etwa 30,2% 261
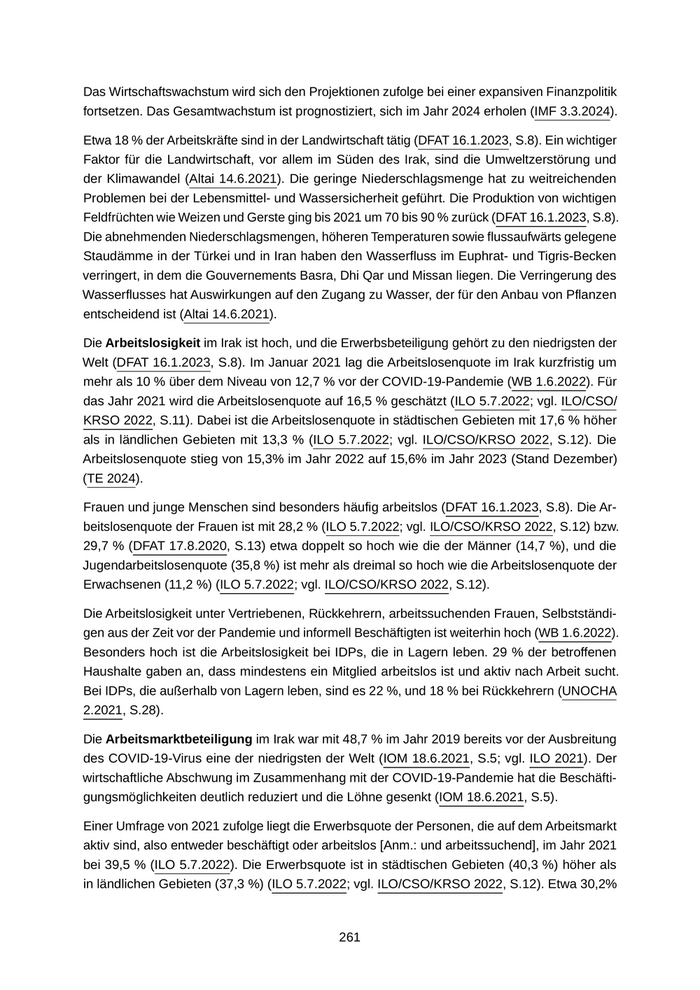
der Gesamtbevölkerung im erwerbsfähigen Alter, größtenteils Frauen, sind nicht erwerbstätig (ILO 5.7.2022). So sind nur etwa 10,6 % der Frauen erwerbstätig, während die Erwerbsquote bei Männern 68 % beträgt (ILO 5.7.2022; vgl.ILO/CSO/KRSO 2022, S.11). Anderen Quellen zufolge liegt die Arbeitsmarktbeteiligung der Frauen bei rund 13% (DFAT 16.1.2023, S.8). Die Erwerbsquote von Jungen (Alter 15-24) liegt bei 26,5%, während die von Erwachsenen (Alter 25+) 45,8% beträgt (ILO 5.7.2022; vgl. ILO/CSO/KRSO 2022, S.11). Einer von der Staatendokumentation in Auftrag gegebenen Umfrage von 2021 in Bagdad, Basra und Mossul zufolge sind etwa 34 % der Stadtbewohner ständig erwerbstätig, 38 % nur gelegent lich und 25 % sind arbeitslos. 12 % der Männer und 40 % der Frauen geben an, arbeitslos zu sein. Die Arbeitslosigkeit betrifft vor allem die 16- bis 18-Jährigen (48 %). 27 % der Einwohner im Alter von 19 bis 25 Jahren und 17 % im Alter von 26 bis 35 Jahren haben keine Arbeit. Während 30 % der Araber arbeitslos sind, sind es nur 10 % der Kurden. Was die Religionszugehörigkeit betrifft, so sind 19 % der Christen, 25 % der schiitischen und 30 % der sunnitischen Muslime arbeitslos. Während 75 % der kontinuierlich Beschäftigten mehr als 700.000 IQD [Anm.: 100.000 IQD entsprechen etwa 71 EUR, Stand August 2023] verdienen, verdienen 62 % der Befragten, die nur gelegentlich arbeiten, weniger als 700.000 IQD (STDOK/IRFAD 2021, S.24-26). 26 % der beschäftigten Befragten arbeiten Vollzeit, 30 % Teilzeit, 10 % haben mehrere Teilzeit stellen, 15 % sind Tagelöhner und 12 % Saisonarbeiter. Interessanterweise ist das Geschlech tergefälle bei der Vollzeitbeschäftigung (24 % der Frauen und 28 % der Männer) viel geringer als bei der Teilzeitbeschäftigung (35 % der Männer und 23 % der Frauen). Von den Kurden geben 29 % an, eine Vollzeitbeschäftigung zu haben, 43 % gehen einer Saison- oder Tagelohnarbeit nach. 22 % der Araber haben eine Vollzeitstelle und 45 % eine oder mehrere Teilzeitstellen. Was die Religionsgemeinschaften betrifft, so haben 20 % der sunnitischen Muslime eine Vollzeitstelle, während 50 % eine oder mehrere Teilzeitstellen haben. Von den schiitischen Muslimen geben 29 % an, eine Vollzeitbeschäftigung zu haben, und 20 % sind als Tagelöhner tätig. 33 % der Christen haben eine Vollzeitbeschäftigung, aber auch 20 % gehen einer Tagelöhnertätigkeit nach. 51 % derjenigen, die eine Teilzeitbeschäftigung oder Tagelohnarbeit ausüben, verdienen weniger als 700.000 IQD, während 57 % derjenigen, die Vollzeit arbeiten, mehr als 700.000 IQD verdienen (STDOK/IRFAD 2021, S. 27-29). Einer weiteren von der Staatendokumentation beauftragten Umfrage (n = 612) in Bagdad, Basra und Mossul von 2023 zufolge sind 35 % ständig erwerbstätig, während 20 % Gelegenheitsjobs haben. 12 % der Umfrageteilnehmer sind arbeitslos bzw. arbeiten derzeit nicht, während 13 % eine Ausbildung absolvieren. 20 % sind Hausfrauen. Der Geschlechtervergleich zeigt, dass 40 % der männlichen Befragten kontinuierlich arbeiten, während dies auf 31 % der weiblichen Befragten zutrifft. 35 % der männlichen Befragten, aber nur 5 % der weiblichen Befragten arbeiten gelegentlich. Der Anteil der Vollzeitbeschäftigten ist bei den weiblichen Befragten (76 %) höher ist als bei den männlichen Befragten (40 %). Dagegen ist der Anteil der Tagelöhner bei den Männern (44 %) höher als bei den Frauen (4 %). 10 % der männlichen Befragten sind teilzeitbeschäftigt, während dies bei 15 % der weiblichen Befragten der Fall ist. 3 % sowohl der männlichen als auch der weiblichen Befragten haben mehrere Teilzeitstellen, während 3 % der männlichen und 2 % der weiblichen Befragten als Saisonarbeiter tätig sind. Was die Art 262
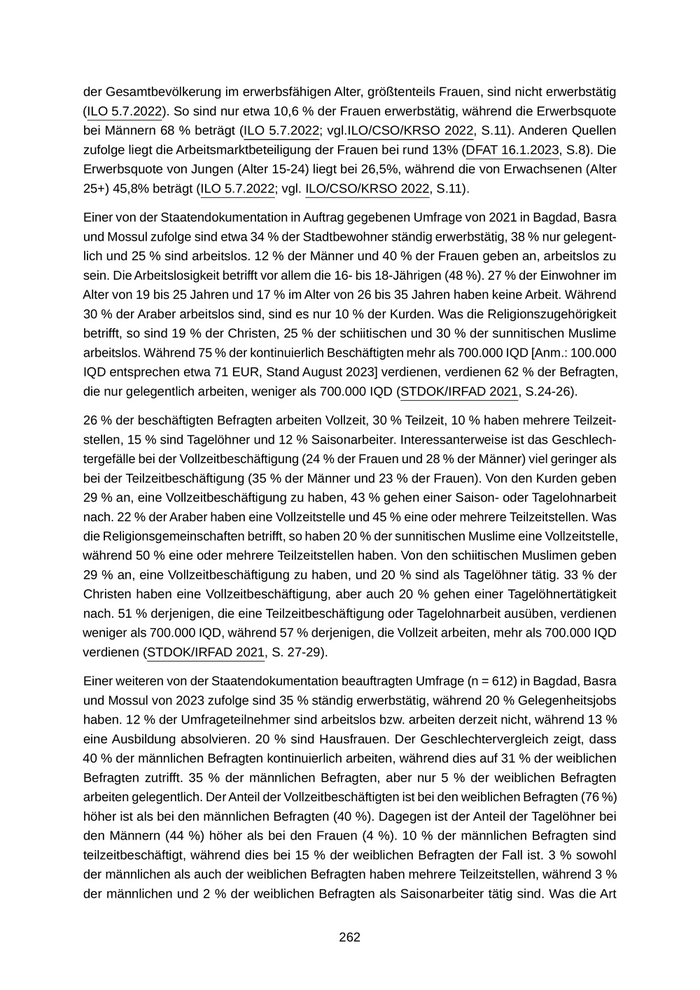
der Beschäftigung angeht, so sind 51 % der ständig oder gelegentlich Erwerbstätigen (n = 341) Vollzeitbeschäftigte, während 12 % Teilzeitbeschäftigte sind. 3 % aller erwerbstätigen Befragten haben mehrere Teilzeitbeschäftigungen, und 2 % arbeiten als Saisonarbeiter. 32 % bezeichneten sich als Tagelöhner (STDOK 2023, S.13-18). Die Armutsrate ist infolge der Wirtschaftskrise bis Juli 2020 auf ca. 30 % angestiegen (AA 25.10.2021, S.12; vgl. ILO 2021). Anfang 2021 lag sie bei 22,5 % (WB 5.4.2021) und 2022 bei etwa 19 % (DFAT 16.1.2023, S.8). Dabei ist die Armutsrate in ländlichen Gebieten deut lich höher als in städtischen (ILO 2021). Internationale Beobachter rechnen damit, dass die COVID-19-Pandemie und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Steigerung der Armutsrate mit sich brachten (AA 28.10.2022, S.22). Aufgrund der COVID-19-Pandemie hatte die irakische Regierung Schwierigkeiten, die Gehälter der sechs Millionen Staatsbediensteten zu zahlen, und Millionen von Menschen, die im privaten und informellen Sektor arbeiten, haben ihre Beschäftigung und ihre Lebensgrundlage verloren. Nach Schätzungen von UNICEF und der Weltbankgruppe fielen im Jahr 2020 rund 4,5 Millionen Iraker unter die Armutsgrenze von 1,90 US-Dollar pro Tag (IOM 18.6.2021, S.5). Einhergehend mit dem neuerlichen Ansteigen der Ölpreise wird auch eine Reduktion der Armutsrate um 7 bis 14 % erwartet (WB 5.4.2021). Die Löhne liegen zwischen 200 und 2.500 USD [163,8 und 2.047,45 EUR] [Anm.: 100 USD entsprechen rund 131.000 IQD, bzw. 94 EUR], je nach Qualifikation und Ausbildung. Für unge lernte Arbeitskräfte liegt das Lohnniveau etwa zwischen 200 und 400 USD [163,8 und 327,59 EUR] pro Monat (IOM 18.6.2021, S.6). Der oben zitierten Befragung von 2021 zufolge verdie nen 56 % der Befragten weniger als 600.000 IQD [360 EUR] und nur 5 % zwischen 1.000.000 und 3.000.000 IQD [600 bis 1.800 EUR]. In der Einkommensgruppe unter IQD 600.000 sind 58 % Frauen und 55 % Männer, in der Gruppe mit einem Einkommen zwischen 1.000.000 und 3.000.000 IQD sind 7 % Männer und nur 2 % Frauen. Die regionalen Daten zeigen, dass in Bagdad 54 % weniger als 600.000 IQD verdienen und nur 1,5 % zwischen 1.000.000 und 3.000.000 IQD. In Basra haben 61 % ein Einkommen unter 600.000 IQD und 9 % verdienen zwischen 1.000.000 und 3.000.000 IQD. In Mossul verdienen 56 % weniger als 600.000 IQD, während 10 % zwischen 1.000.000 und 3.000.000 IQD liegen. 55 % der arabischen Befragten verdienen weniger als 600.000 IQD, während 5 % zwischen 1.000.000 und 3.000.000 IQD ver dienen. Von den kurdischen Befragten verdienen 54 % unter 600.000 IQD und 3 % zwischen 1.000.000 und 3.000.000 IQD. Nach Religionszugehörigkeit verdienen 61 % der Christen, 50 % der schiitischen Muslime und 59 % der sunnitischen Muslime weniger als 600.000 IQD (STDOK/ IRFAD 2021, S.29-30). Nahrungsmittelversorgung Der Irak ist in hohem Maße von Nahrungsmittelimporten (schätzungsweise 50 % des Nahrungs mittelbedarfs) abhängig (FAO 30.6.2020, S.9). Grundnahrungsmittel sind in allen Gouverne ments verfügbar (IOM 18.6.2021, S.9). Aufgrund von Panikkäufen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie kam es in den letzten beiden Märzwochen 2020 zu einem vorübergehenden Preisanstieg für Lebensmittel. 263
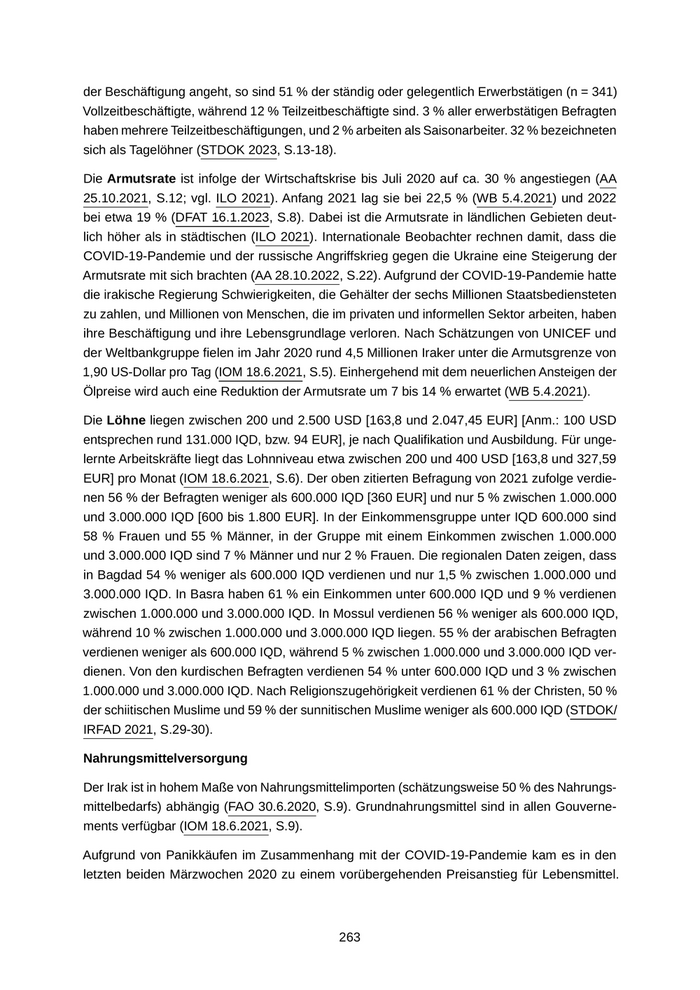
Strenge Preiskontrollmaßnahmen der Regierung führten ab April 2020 zuerst zu einer Stabi lisierung der Preise und ab Mai 2020 wieder zu einer Normalisierung (FAO 30.6.2020, S.17). Die lokalen Märkte haben sich in allen Gouvernements als widerstandsfähig angesichts der Pandemie bewährt (UNOCHA 2.2021, S.30). Vor der COVID-19-Krise war eines von fünf Kindern unter fünf Jahren unterernährt. 3,3 Millionen Kinder sind laut UNICEF immer noch auf humanitäre Unterstützung angewiesen (AA 25.10.2021, S.12). Im Jahr 2022 sind laut UNICEF 1,1 Mio. Kinder im Irak auf humanitäre Unterstützung angewiesen, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (AA 28.10.2022, S.11). Etwa 4,1 Millionen Iraker benötigen humanitäre Hilfe (FAO 11.6.2021, S.2). Mit Stand Mai 2023 sind etwa 1,2 Millionen Iraker unzureichend ernährt, während für rund 2,5 Millionen Iraker die Deckung des Nahrungsmittelbedarfs kritisch ist. 2,5 % der unter-fünfjährigen Kinder sind von akuter Unterernährung betroffen, 9,9 % sind chronisch unterernährt (WFP o.D.). Alle Iraker, die als Familie registriert sind und über ein monatliches Einkommen von höchstens 1.000.000 IQD [Anm.: 100.000 IQD entsprechen etwa 71 EUR, Stand August 2023] verfügen, haben Anspruch auf Zugang zum Public Distribution System (PDS) (IOM 18.6.2021, S.9; vgl. USDOS 20.3.2023). Das PDS ist ein universelles Lebensmittelsubventionsprogramm der Re gierung, das als Sozialschutzprogramm kostenlose Lebensmittel subventioniert oder verteilt (WB 2.2020). Formal erfordert die Registrierung für das PDS die irakische Staatsbürgerschaft sowie die Anerkennung als „ Familie“, die durch einen rechtsgültigen Ehevertrag oder eine Ver wandtschaft ersten Grades (Eltern, Kinder) erreicht wird. Alleinstehende Rückkehrer können sich bei ihren Verwandten ersten Grades registrieren lassen, z. B. bei ihrer Mutter oder ihrem Vater. Sollten alleinstehende Rückkehrer keine Familienangehörigen haben, bei denen sie sich anmelden können, erhalten sie keine PDS-Unterstützung (IOM 18.6.2021, S.9-10). Die ange schlagene finanzielle Lage des Irak wirkt sich auch auf das PDS aus (WB 5.4.2021). In den vorangegangenen Jahren hat die Regierung nur Mehl verteilt, aber keine anderen Waren wie Speiseöl oder Zucker. Ein Vorschlag der Regierung, die PDS-Nahrungsmittelverteilung durch Bargeldzahlungen (IQD 17.000, ca. 12 $ pro Person) zu ersetzen, wurde angesichts der an haltenden Sicherheits- und wirtschaftlichen Instabilitäten noch nicht umgesetzt (BS 23.2.2022, S.26). Der Anteil der Haushalte, der im Rahmen des PDS-Systems Überweisungen erhalten hat, ist um etwa 8 % gesunken. Der Verlust von Haushaltseinkommen und Sozialhilfe hat die Anfälligkeit für Ernährungsunsicherheit erhöht (WB 5.4.2021). Das Programm wird von den Behörden jedoch nur sporadisch und unregelmäßig umgesetzt, mit begrenztem Zugang in den wiedereroberten Gebieten. Die Behörden verteilen nicht jeden Monat alle Waren, und nicht in je dem Gouvernement haben alle Binnenvertriebenen (IDPs) Zugang zum PDS. Es wird berichtet, dass IDPs den Zugang zum PDS verloren haben, aufgrund der Voraussetzung, dass Bürger nur an ihrem registrierten Wohnort PDS-Rationen und andere Dienstleistungen beantragen können (USDOS 20.3.2023). 62 % der Befragten sind einer Umfrage von 2021 zufolge in der Lage oder schaffen es gerade noch, sich und ihre Familie ausreichend mit Lebensmitteln zu versorgen. 34 % schaffen dies kaum oder gar nicht. 55 % der Frauen geben an, dass sie in der Lage, oder gerade noch in der Lage sind, sich mit Lebensmitteln zu versorgen, im Gegensatz zu 70 % der Männer. Die 264
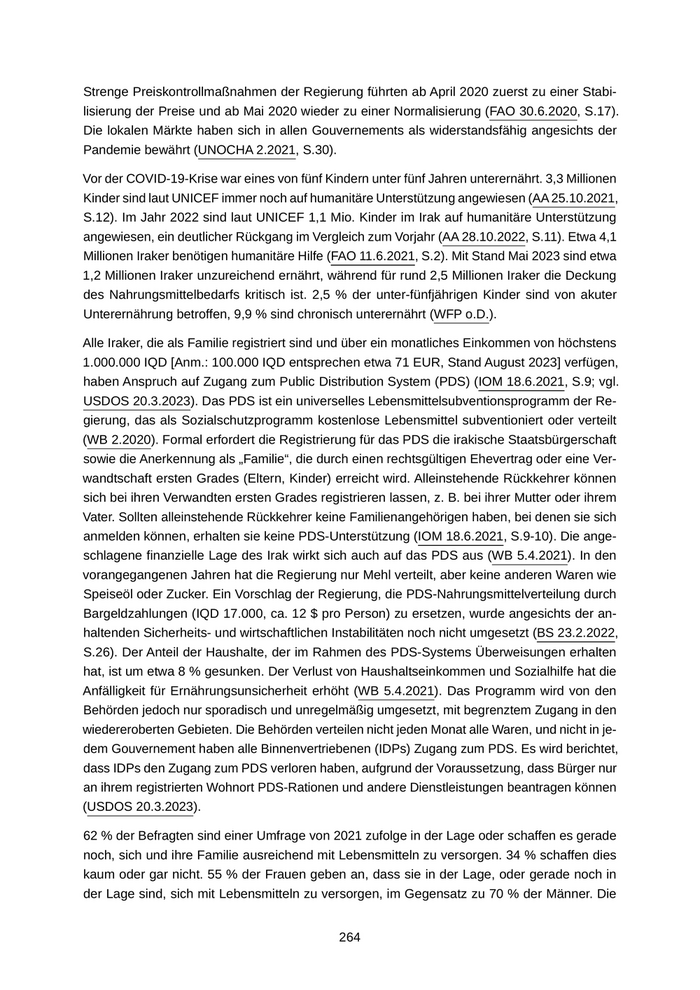
regionalen Antwortmuster zeigen, dass in Bagdad 59 % in der Lage oder gerade noch in der Lage sind, für Nahrungsmittel zu sorgen, ebenso wie 63 % in Basra und 69 % in Mossul. Insbesondere die 16- bis 18-Jährigen (56 %) geben an, nicht oder kaum in der Lage zu sein, sich selbst mit Lebensmitteln zu versorgen. Die ethnische Zugehörigkeit zeigt, dass 62 % der Araber und 58 % der Kurden nicht oder kaum in der Lage sind, sich selbst oder ihre Familien zu versorgen. Die Religionszugehörigkeit zeigt, dass 63 % der Christen, 62 % der schiitischen Muslime und 66 % der sunnitischen Muslime in der Lage, oder gerade noch in der Lage sind, sich ausreichend mit Lebensmitteln zu versorgen. Sogar 73 % derjenigen, die weniger als 700.000 IQD verdienen, sind in der Lage, sich selbst zu versorgen, oder schaffen es gerade noch (STDOK/IRFAD 2021, S.31-33). Der Umfrage von 2023 (n = 612) zufolge schaffen es 40 % der Befragten, ihre Familie ausrei chend mit Lebensmitteln zu versorgen (Bagdad 44 %, Basra 38 %, Mossul 37 %), 28 % gerade so (Bagdad 27 %, Basra 31 %, Mossul 27 %), 29 % kaum (Bagdad 26 %, Basra 28 %, Mossul 34 %) und 3 % nicht (Bagdad 3 %, Basra 3 %, Mossul 2 %). Im Geschlechtervergleich ist der An teil jener, die ihre Familie ausreichend mit Lebensmitteln versorgen können, bei den weiblichen Befragten (46 %) höher als bei den männlichen Befragten (33 %), während 30 % der befragten Frauen und 27 % der befragten Männer es gerade so schaffen, ihre Familie ausreichend mit Lebensmitteln zu versorgen. Im Gegensatz dazu schaffen es 36 % der Männer und 22 % der Frauen kaum, ihre Familie ausreichend mit Lebensmitteln zu versorgen, während es 4 % der Männer und 2 % der Frauen nicht schaffen (STDOK 2023, S.30, 32). Der Umfrage von 2021 zufolge sind 54 %der Befragten in der Lage oder schaffen es gerade noch, sich mit grundlegenden Konsumgütern zu versorgen, wie z.B. Kleidung, Schuhe oder einem Mobiltelefon, während 42 % dies nicht tun. Während 61 % der Männer angeben, dass sie in der Lage sind, sich und ihre Familie zu versorgen, gelingt dies 49 % der Frauen kaum oder gar nicht. Regional ergibt sich ein unterschiedliches Bild: In Bagdad sind 53 % in der Lage, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, ebenso wie 60 % in Mossul, während 49 % in Basra kaum oder gar nicht dazu in der Lage sind (in Basra schaffen es 32 % überhaupt nicht). Vor allem Jugendliche (71 %) im Alter von 16 bis 18 Jahren geben an, dass sie nicht in der Lage sind, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, während die 19- bis 25-Jährigen (56 %) und die Gruppe der 26- bis 35-Jährigen (63 %) es schaffen bzw. gerade noch dazu in der Lage sind. 51 % der Araber geben an, dass sie in der Lage sind, sich mit grundlegenden Konsumgütern zu versorgen, oder es gerade so schaffen, ebenso wie 53 % der Kurden. Was die religiösen Gruppen betrifft, so geben 58 % der Christen, 53 % der schiitischen Muslime und 57 % der sunnitischen Muslime an, dass sie in der Lage sind, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, oder es gerade noch schaffen. Von denjenigen, die weniger als 700.000 IQD verdienen, sind 57 % in der Lage, sich mit grundlegenden Konsumgütern zu versorgen, bzw. gerade noch (STDOK/ IRFAD 2021, S.33-35). Der Umfrage von 2023 (n = 612) zufolge sind 30 % der Befragten in der Lage, ihre Familie mit grundlegenden Konsumgütern wie Kleidung oder Schuhen zu versorgen (Männer 30 %, Frauen 29 %; Bagdad 28 %, Basra, 32 %, Mossul 30 %), während 35 % gerade noch dazu in der Lage sind (Männer 28 %, Frauen 42 %; Bagdad 39 %, Basra 36 %, Mossul 31 %), 32 % es kaum 265