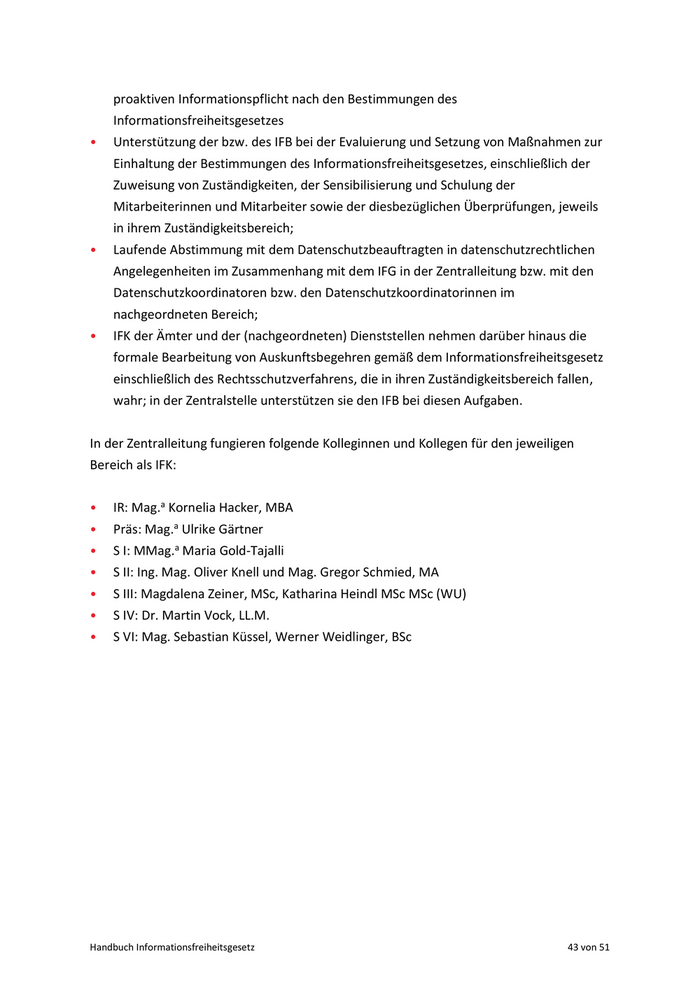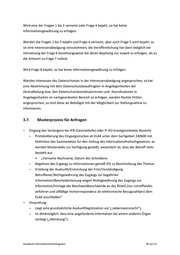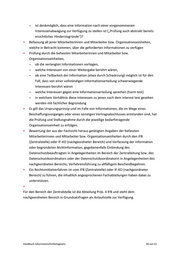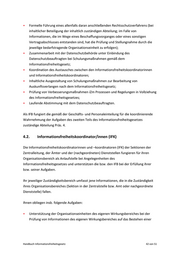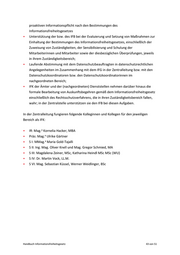handbuchinformationsfreiheitsgesetz_geschwaerzt
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Leitlinien, Regeln und Handlungsanweisungen zur Informationsfreiheit“
Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 34 von 51 Wurde festgestellt, dass ein Eingriff in das Recht auf freie Meinungsäußerung vorliegt, ist zu prüfen, ob dieser gerechtfertigt ist (dem materiellen Gesetzesvorbehalt in Art. 10 Abs. 2 EMRK entspricht). Hierfür muss der Eingriff auf Basis einer gesetzlichen Grundlage einen legitimen Eingriffszweck verfolgen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig und im Ergebnis verhältnismäßig sein. Die Abwägungsentscheidung ist hinreichend zu begründen. 3.3. Wie Grundsätzlich soll ein relativ formloses Informationsbegehren genügen. Eine schriftliche Klarstellung kann unter Umständen erforderlich sein. Dabei gilt die behördliche Manuduktionspflicht (§ 13a des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzeses 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991). Ein schriftlich präzisierter Antrag gilt, da erst dieser die Antragsvoraussetzungen erfüllt und nichts Anderes geregelt ist, mit dem Tag seines Einlangens bei der informationspflichtigen Stelle als eingebracht. Mängel schriftlicher Anbringen führen nicht zur Zurückweisung, sondern allenfalls zu einem Verbesserungsauftrag (§ 13 Abs. 3 AVG). Unbeschadet der Geltung des § 6 Abs. 1 AVG (vgl. Abs. 4), wurde zur Klarstellung eine Weiterleitungspflicht normiert. Soweit im Informationsfreiheitsgesetz nichts anderes bestimmt ist, sollen die Bestimmungen des AVG anzuwenden sein (ua. betreffend Vertretung, Niederschriften, Aktenvermerke, Ladungen, Zustellungen, Fristenberechnung und Bescheide). Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Rechtsauffassungen zum auskunftsrechtlichen Verfahren vor einem Antrag auf Bescheiderlassung soll gesetzlich ausdrücklich klargestellt werden, dass bereits die Informationserteilung eine behördliche Aufgabe ist (Abs. 4; vgl. Artikel I Abs. 1 des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 – EGVG, BGBl. I Nr. 87/2008). Wenn das informationspflichtige Organ im Rahmen der erforderlichen Abwägung zwischen dem Grundrecht auf Informationszugang und den Rechten eines anderen (vgl. § 6 Abs. 1 Z 7 IFG) vorläufig zur Auffassung gelangt, die Information sei im konkreten Fall zu erteilen, weil die gegenläufigen Rechte anderer nicht als schwerer wiegend zu erachten seien, soll dem bzw. der von der beabsichtigten Informationserteilung Betroffenen zwar keine Parteistellung im Verfahren eingeräumt, aber Gelegenheit zur Stellungnahme
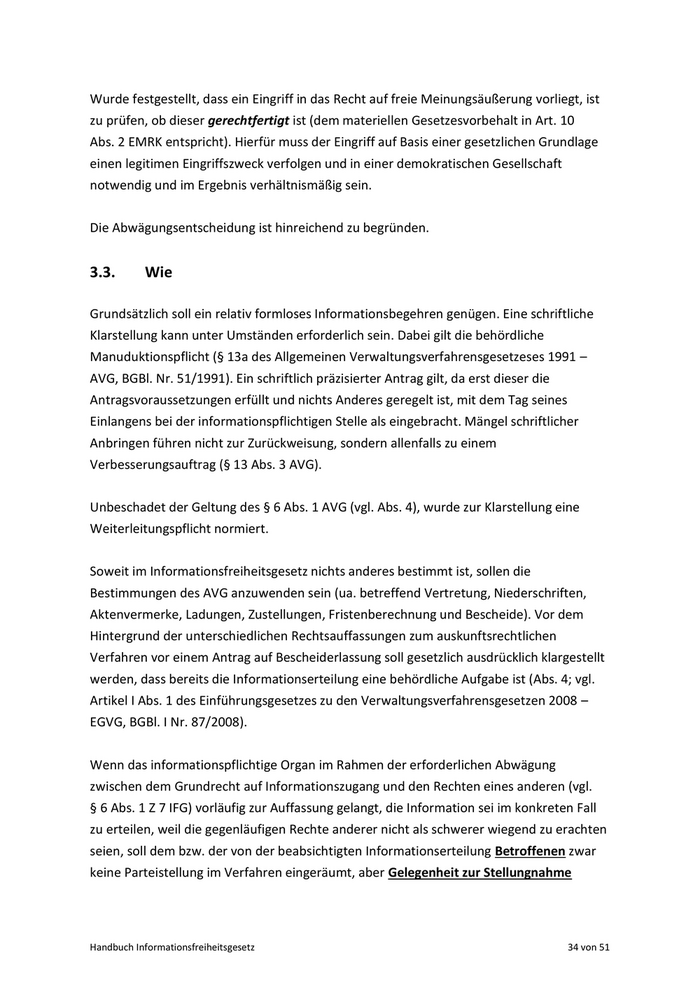
Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 35 von 51 mittels Anhörung gegeben werden, wenn dies möglich ist. Damit soll dem Informationspflichtigen die Abwägungsentscheidung aufbereitet und dafür gesorgt werden, dass der bzw. die Betroffene von der beabsichtigten Informationserteilung überhaupt erfährt und die eigenen Rechte wahrnehmen kann. Die Stellungnahme soll die Behörde zwar nicht binden, aber eine (wesentliche) Grundlage für die von ihr vorzunehmende Interessenabwägung darstellen. „[N]ach Möglichkeit“ bedeutet, dass das informationspflichtige Organ in dem Ausmaß zur Anhörung verpflichtet werden soll, als einer solchen keine faktische Hindernisse entgegenstehen. Auch aus zeitlichen Schranken kann sich eine Unmöglichkeit ergeben, weil die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Fristen einzuhalten sind. Die Anhörungspflicht soll insbesondere davon abhängen, ob die Behörde den Kontakt zum bzw. zur Betroffenen in diesem zeitlichen und sonst verhältnismäßigen Rahmen herstellen kann. Aufwendige Recherchen, wer überhaupt Betroffener bzw. Betroffene sein könnte, sollen nicht anzustellen sein. Ebenso kann die Anhörung einer sehr großen Anzahl Betroffener innerhalb der vorgesehenen Frist sich als nicht zu bewältigen und daher „unmöglich“ erweisen. Der bzw. die von der Informationserteilung Betroffene ist über die Erteilung der Information jedenfalls zu informieren (vgl. die Vorbildbestimmung des § 7 Abs. 2 UIG). Erachtet sich der bzw. die Betroffene dadurch im eigenen Grundrecht auf Datenschutz als verletzt, bleibt es ihm bzw. ihr unbenommen, (gemäß § 24 DSG iVm. Art. 77 DSGVO) Beschwerde an die Datenschutzbehörde zu erheben. Macht der Beschwerdeführer im Rahmen der Beschwerde eine wesentliche Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen durch die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten glaubhaft, kann die Datenschutzbehörde die Weiterführung der Datenverarbeitung mit Mandatsbescheid (vgl. § 57 Abs. 1 AVG) untersagen, teilweise untersagen oder einschränken (§ 25 Abs. 1 iVm. § 22 Abs. 4 DSG). Die Zuständigkeit der Datenschutzbehörde, über eine Verletzung des Grundrechts auf Datenschutz zu entscheiden, soll von der vorgeschlagenen Anhörung unberührt bleiben. Daran ändert auch der Rechtsweg an die Verwaltungsgerichte im Verfahren zur Informationserteilung nichts: Auch das Verwaltungsgericht hat den bzw. die in seinem bzw. ihrem Recht auf Datenschutz Betroffenen anzuhören (§ 17 des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes – VwGVG, BGBl. I Nr. 33/2013, iVm. § 10). Das Verwaltungsgericht kann die Information nicht selbst erteilen, sondern nur aussprechen, dass die Information zu erteilen ist. Der bzw. die datenschutzrechtlich Betroffene kann gegen ein solches Erkenntnis zwar kein Rechtsmittel erheben, weil er bzw. sie nicht Partei des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ist und ein Rechtsweg vom Verwaltungsgericht an die Datenschutzbehörde nicht vorgesehen ist bzw. die Datenschutzbehörde als nationale Aufsichtsbehörde gemäß Art. 55 Abs. 3 DSGVO für die Überprüfung gerichtlicher Entscheidungen nicht zuständig ist,
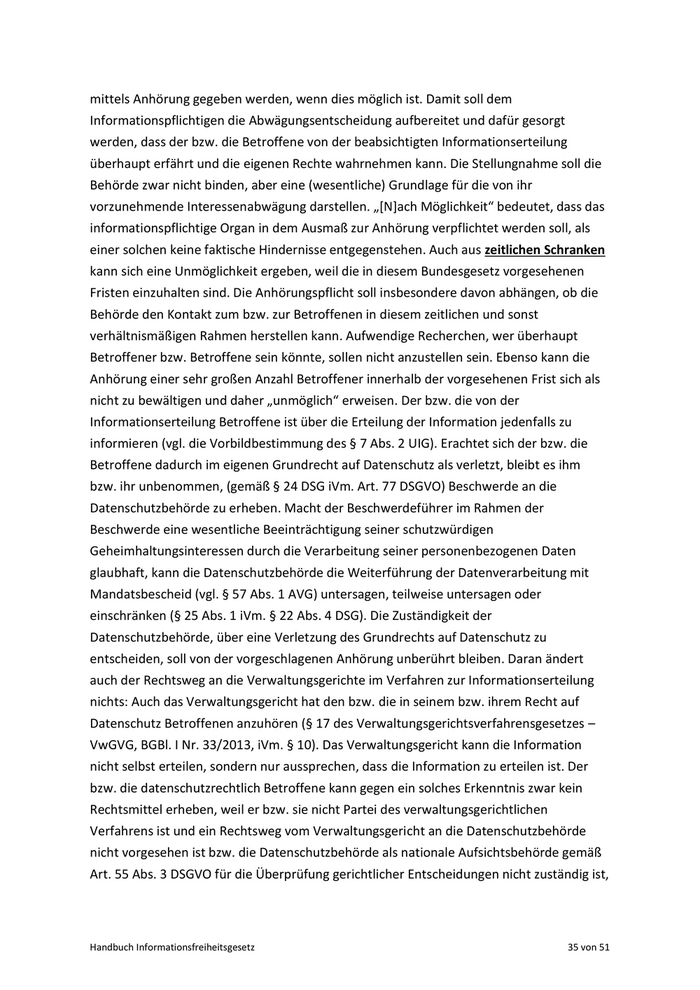
Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 36 von 51 allerdings bleibt es dem bzw. der datenschutzrechtlich Betroffenen unbenommen, gegen den gewährten Informationszugang eine Beschwerde an die Datenschutzbehörde zu erheben, da der gewährte Informationszugang (und damit die potenzielle Verletzung von Datenschutzrechten) in der Folge ohnehin durch die informationspflichtige Stelle zu erfolgen hat. Durch den Rechtsweg, der auch gegen die Entscheidung der Datenschutzbehörde an das Verwaltungsgericht offensteht, und in beiden Fällen (Verfahren zur Informationserteilung und Datenschutzbeschwerde) letztlich zum VwGH und zum VfGH führt, ist nach Ansicht des Gesetzgebers für eine einheitliche Auslegung und Anwendungspraxis gesorgt. Im Übrigen geht auch Art. 77 Abs. 1 DSGVO von einem möglicherweise parallelen Rechtsweg aus (vgl. „unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde“). Auf die bei Inkrafttreten des Informationsfreiheitsgesetzes (1.9.2025) anhängigen Verfahren betreffend die Erteilung einer Auskunft sollen Art. 20 Abs. 3 und 4 B-VG in der derzeit geltenden Fassung und die auf Grund des Art. 20 Abs. 4 B-VG erlassenen Gesetze und die auf deren Grundlage erlassenen Verordnungen weiter anzuwenden sein. 3.4. Wo Die Information ist in der beantragten oder sonst tunlichen Form, möglichst durch die Gewährung von unmittelbarem Zugang zur Information, zu erteilen. Die begehrte Information kann aber zum Beispiel auch mündlich erteilt werden, wenn dem Informationsbegehren damit entsprochen wird. Bereits proaktiv veröffentlichte Informationen brauchen nicht noch einmal auf Antrag erteilt zu werden. Auf bereits veröffentlichte Informationen darf verwiesen werden. Ausnahmsweise kann es in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen, in denen das Internet nicht genutzt werden kann, allerdings (etwa auf Grund fortgeschrittenen Alters oder einer Behinderung) angezeigt sein, trotz erfolgter Veröffentlichung auch einen individuellen Informationszugang zu gewähren. Ein teilweiser Informationszugang soll möglich sein, sofern die Information teilbar, die teilweise Informationserteilung möglich ist und ein verhältnismäßiger Aufwand nicht überschritten wird. Eine Missbrauchsschranke ist ebenso vorgesehen (vgl. dazu die ständige Rsp. des VwGH zur offenkundigen Mutwilligkeit, gekennzeichnet durch Inanspruchnahme der Behörde „in dem Bewusstsein der Grundlosigkeit und Aussichtslosigkeit, der Nutzlosigkeit und Zwecklosigkeit“ oder „aus Freude an der
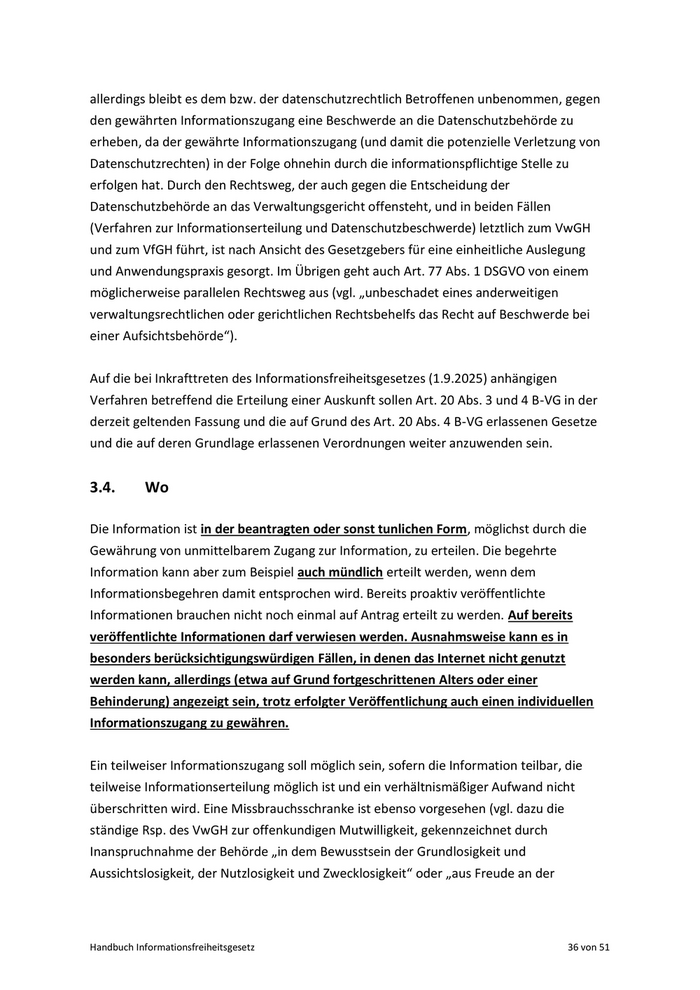
Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 37 von 51 Behelligung“ ohne konkretes Auskunftsinteresse, zum Beispiel VwGH 29.5.2018, Ra 2017/03/0083, unter Berufung auf VwGH 13.9.2016, Ra 2015/03/0038) wie die Grenze eines unverhältnismäßigen Behördenaufwands (Abs. 3; zum unverhältnismäßigen Aufwand vgl. zum Beispiel VwGH 29.5.2001, 98/03/0007 und grundlegend EGMR 28.11.2013, Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes, BeschwerdeNr. 39534/07). Allein die Tatsache, dass etwa im Zusammenhang mit journalistischen Recherchen zum Zweck der Ermöglichung einer öffentlichen Debatte vermehrt Anfragen gestellt werden, indiziert jedenfalls noch keinen Missbrauch des Informationsrechts. Ebenso wenig begründen knappe oder mangelnde Ressourcen des Informationspflichtigen in jedem Fall und ohne Weiteres einen unverhältnismäßigen Aufwand. Im Fall der Nichterteilung, teilweisen oder nicht antragsgemäßen Erteilung der Information ist auf Antrag unverzüglich, spätestens aber nach Ablauf von zwei Monaten nach Einlangen dieses Antrages, ein (negativer) Bescheid darüber zu erlassen. In dem zur Bescheiderlassung führenden Verfahren gelten (subsidiär) die Bestimmungen des AVG (vgl. Art. I Abs. 1 iVm. Abs. 2 Z 1 des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 – EGVG, BGBl. I Nr. 87/2008), nach Maßgabe der im Informationsfreiheitsgesetz vorgesehenen Abweichungen. Wie nach der bisherigen Praxis üblich, soll es auch weiterhin zulässig sein, gleichzeitig mit dem ursprünglichen Antrag auf Informationszugang für den Fall der Nichterteilung einen Eventualantrag auf Erlassung eines Bescheids zu stellen. Die zweimonatige Frist zur Bescheiderlassung beginnt auch in dem Fall freilich erst mit der Mitteilung, dass die Information nicht erteilt wird. Der Bescheid kann mittels Bescheidbeschwerde bei den in der Sache jeweils zuständigen Verwaltungsgerichten und bei behaupteter Verletzung des Grundrechts auf Informationszugang letztlich beim VfGH angefochten werden. Damit können die (auch partielle) Nichterteilung der begehrten Information sowie unter Umständen auch die (behauptetermaßen rechtswidrige) Art und Weise der Erteilung einer Information angefochten werden. Für das Verwaltungsgericht soll dabei eine Entscheidungsfrist von zwei Monaten gelten. Dementsprechend ist es erforderlich, auch die Frist zur Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung gemäß § 14 VwGVG entsprechend zu verkürzen. Im Säumnisfall soll die Möglichkeit der Nachholung des Bescheides (§ 16 VwGVG) mangels Aussicht auf Erfolg und zur Straffung des Verfahrens ausgeschlossen werden. Im Übrigen soll sich das Verfahren des Verwaltungsgerichts nach den allgemeinen Bestimmungen des VwGVG richten. Das Verwaltungsgericht soll in Angelegenheiten der Informationsfreiheit durch Einzelrichter erkennen (vgl. § 2 VwGVG), auch wenn im
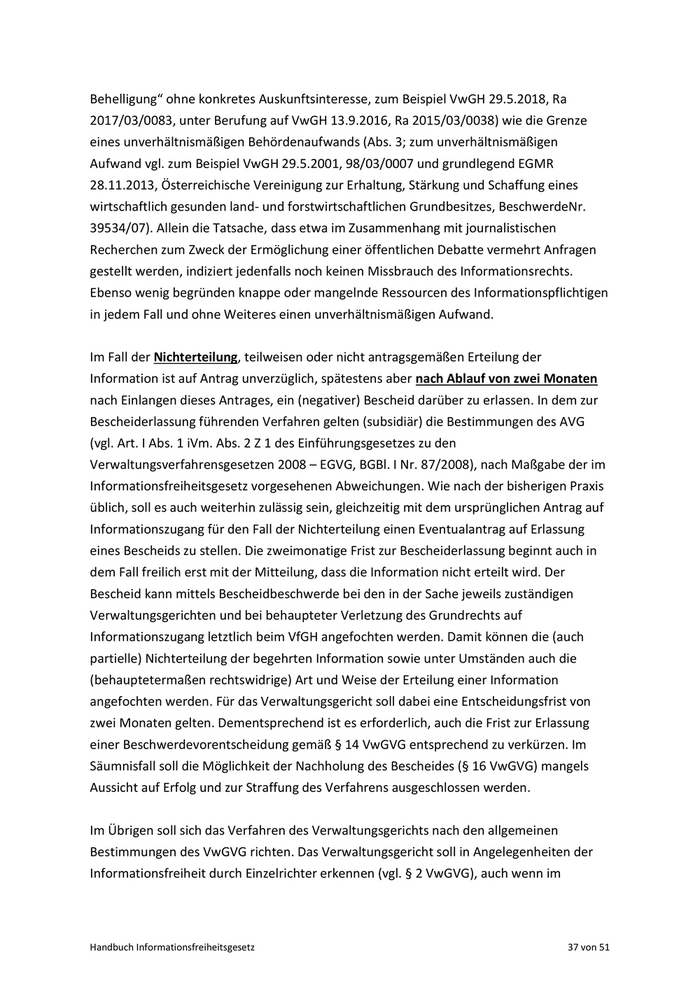
Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 38 von 51 Materiengesetz, zu dem die Information erteilt werden soll, eine Senatszuständigkeit vorgesehen ist; es handelt sich in der Sache dennoch um eine Angelegenheit der Informationsfreiheit, das maßgebliche Bundesgesetz (Materiengesetz) ist das Informationsfreiheitsgesetz. Das Verwaltungsgericht hat nach Maßgabe des § 28 VwGVG in der Sache selbst zu entscheiden. 3.5. Wann: Spätestens binnen einer Frist von vier Wochen ist entweder die Information zu erteilen oder über die Nichterteilung zu informieren (Abs. 1). Diese Frist soll aus besonderen Gründen sowie, wenn eine von der Informationserteilung betroffene Person zu hören (§ 10) und dies nicht binnen der vierwöchigen Frist zu bewerkstelligen ist, höchstens um weitere vier Wochen verlängert werden können (Abs. 2). Im Fall der Nichterteilung, teilweisen oder nicht antragsgemäßen Erteilung der Information ist auf Antrag unverzüglich, spätestens aber nach Ablauf von zwei Monaten nach Einlangen dieses Antrages, ein (negativer) Bescheid darüber zu erlassen. 3.6. In kurzen Worten – Checkliste 1. Liegt ein Antrag auf Zugang zu Informationen vor? 2. Ist eine Zuständigkeit für die angesprochene Information und deren Verfügbarkeit gegeben? 3. Handelt es sich um eine Information im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes? 4. Bestehen besondere Informationszugangsregelungen (zum Beispiel nach dem UIG) bzw. ist ein spezielles öffentliches elektronisches Register für den Zugang zur Information eingerichtet (zum Beispiel Transparenzdatenbank) oder wurde die Information ohnehin bereits veröffentlicht in Wahrnehmung der Verpflichtung zur proaktiven Informationspflicht? 5. Liegen Ausnahmetatbestände bzw. Geheimhaltungsgründe vor? 6. Überwiegen die Geheimhaltungsinteressen in der Abwägung gegen das Auskunftsinteresse (harm test und interest test)? 7. Ist eine teilweise Veröffentlichung jener Informationen möglich, auf welche das Überwiegen der Geheimhaltungsinteressen in der Abwägung gegen das Auskunftsinteresse (harm test und interest test) nicht zutrifft? 8. Ist die Beantragung des Zugangs zur Information offenbar missbräuchlich erfolgt bzw. würde die Erteilung der Information die Erfüllung der sonstigen Tätigkeit des Organs wesentlich und unverhältnismäßig beeinträchtigen?
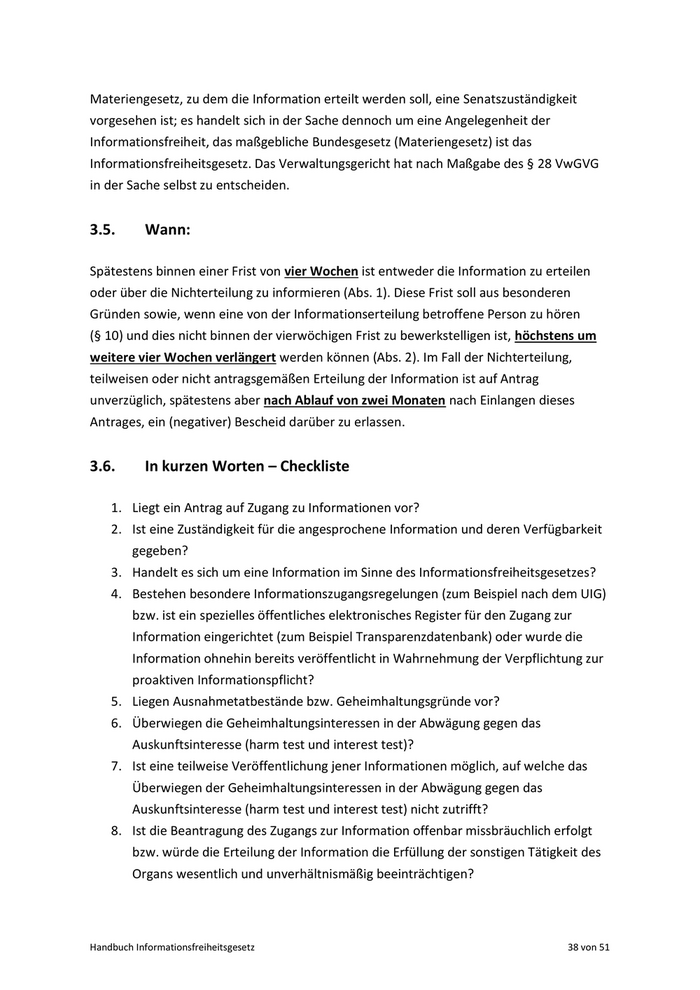
Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 39 von 51 Wird eine der Fragen 1 bis 3 verneint oder Frage 4 bejaht, so hat keine Informationsgewährung zu erfolgen. Werden die Fragen 1 bis 3 bejaht und Frage 4 verneint, aber auch Frage 5 wird bejaht, so ist eine Interessenabwägung vorzunehmen; die Veröffentlichung hat dann lediglich bei Verneinung der Frage 6 beziehungsweise bei deren Bejahung nur soweit zu erfolgen, als es die Antwort zu Frage 7 zulässt. Wird Frage 8 bejaht, so hat keine Informationsgewährung zu erfolgen. Werden Interessen des Datenschutzes in der Interessenabwägung angesprochen, so hat eine Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten in Angelegenheiten der Zentralleitung bzw. den Datenschutzkoordinatorinnen und –koordinatoren in Angelegenheiten im nachgeordneten Bereich zu erfolgen, werden Rechte Dritter angesprochen, so sind diese als Beteiligte mit der Möglichkeit zur Stellungnahme zu informieren. 3.7. Musterprozess für Anfragen • Eingang des Verlangens bei IFB (Zentralstelle) oder IF-KO (nachgeordneter Bereich) − Protokollierung des Eingangsstückes im ELAK unter dem Sachgebiet 240600 mit Definition des Sammelaktes für den Vollzug des Informationsfreiheitsgesetzes; es werden Musterelaks zur Verfügung gestellt, wesentlich ist, dass der Betreff stets besteht aus • „Vorname Nachname, Datum des Schreibens − Begehren des Zugangs zu Informationen gemäß IFG zu Beschreibung des Themas − Erteilung der Auskunft/Erstreckung der Frist/Verständigung Betroffener/Nichtgewährung des Zugangs zur begehrten Information/Bescheiderlassung wegen Nichtgewährung des Zugangs zur Information/Vorlage der Beschweidbeschwerde an das BVwG (nur zutreffendes anführen und allfällige Vorkorrespondenz als elektronische Bezugszahl(en) dem ELAK anschließen“ • Vorprüfung: − Liegt eine grundsätzliche Auskunftlegitimation vor („Jedermannsrecht“), − ist denkmöglich, dass eine angeforderte Information bei einem anderen Organ vorliegt („Abtretung“),
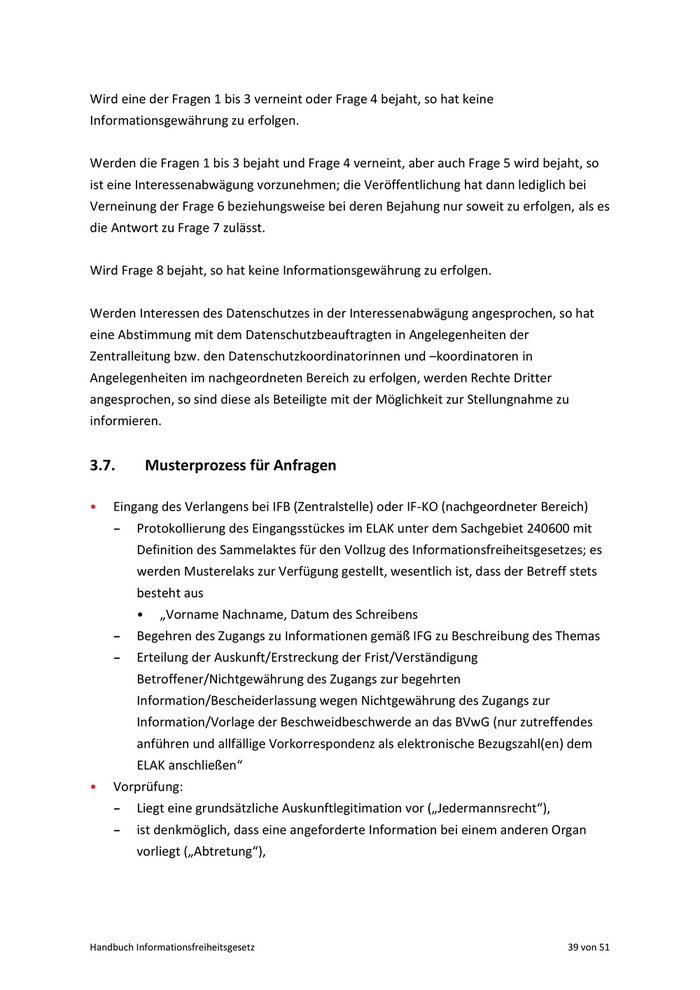
Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 40 von 51 − ist denkmöglich, dass eine Information nach einer vorgenommenen Interessenabwägung zur Verfügung zu stellen ist („Prüfung auch abstrakt bereits ersichtlicher Hindernisgründe“)? • Befassung all jener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Organisationseinheiten, welche in Betracht kommen, über die geforderten Informationen zu verfügen • Prüfung durch die befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Organisationseinheiten, − ob die verlangten Informationen vorliegen, − welche Interessen von einer Weitergabe berührt wären, − ob eine Teilbarkeit der Information (etwa durch Schwärzung) möglich ist für den Fall, dass von einer vollständigen Informationserteilung schwerwiegende Interessen berührt wären − welche Interessen gegen eine Informationserteilung sprechen (harm test) − in welchem Verhältnis diese Interessen zu jenen nach dem interest test gesehen werden mit fachlicher Begründung • Es gilt das Ursprungsprinzip und im Falle von Informationen, die im Wege eines Beschaffungsvorganges oder eines sonstigen Vertragsabschlusses entstanden sind, hat die Prüfung und Stellungnahme durch die jeweilige bedarfstragende Organisationseinheit zu erfolgen. • Bewertung der aus der Fachsicht heraus getätigten Angaben der befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Organisationseinheiten durch den IFB (Zentralstelle) oder IF-KO (nachgeordneter Bereich) und Verfassung der Information oder begründeten Nichtinformation; gegebenenfalls Einbindung des Datenschutzbeauftragten in Angelegenheiten im Bereich der Zentralleitung bzw. des Datenschutzkoordinators oder der Datenschutzkoordinatorin in Angelegenheiten des nachgeordneten Bereichs; Verfahrensführung zu allfälligem Bescheidbegehren. • Ein Rechtsmittelverfahren ist vom IFB (Zentralstelle) oder IF-KO (nachgeordneter Bereich) zu führen, die inhaltlich angesprochenen Fachabteilungen haben dabei zu unterstützen. • Für den Bereich der Zentralstelle ist die Abteilung Präs. 4 IFB und steht dem nachgeordneten Bereich in Grundsatzfragen als Anlaufstelle zur Verfügung.
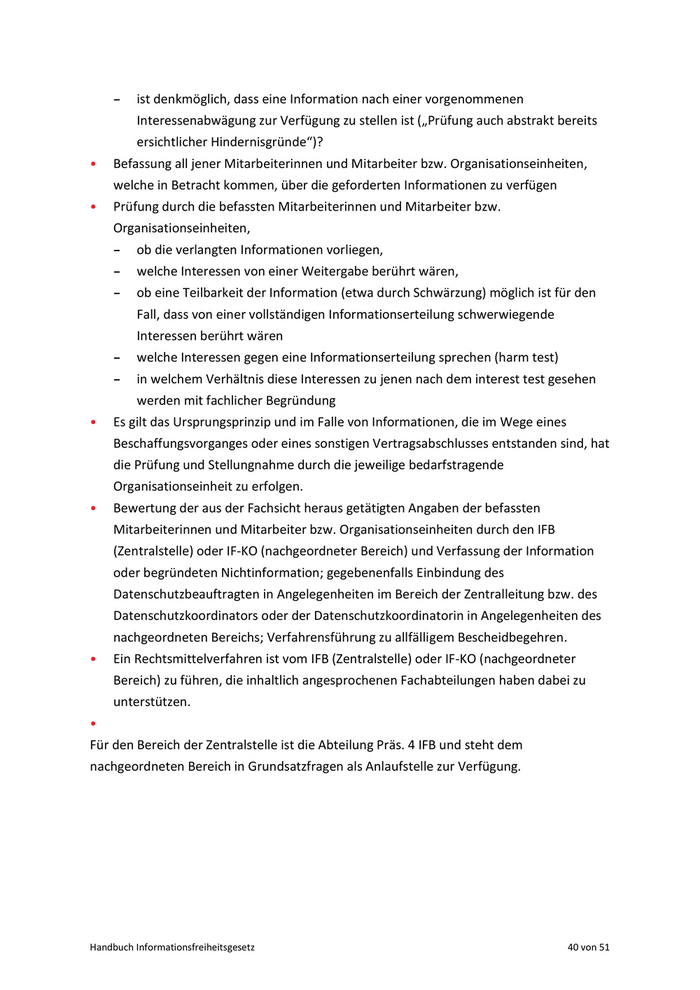
Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 41 von 51 4. Organisatorische Verantwortungsbereiche 4.1. Informationsfreiheitsbeauftragte/r Die bzw. der Informationsfreiheitsbeauftragte (IFB) des BMF fungiert als gemeinsame bzw. gemeinsamer IFB für das gesamte Finanzressort. Die bzw. der IFB ist für die Organisation, die kontinuierliche Evaluierung und die Weiterentwicklung der für die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes erforderlichen Prozesse und Regelungen des Finanzressorts sowie für die begleitende Setzung von Maßnahmen zur bestmöglichen Wahrung der Normkonformität zuständig. Ihr bzw. ihm obliegen insbesondere folgende Aufgaben: • Prüfung und Aktualisierung von Regelungen und Mustervorlagen für die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes; • Unterstützung der Informationsfreiheitskoordinatorinnen und Informationsfreiheitskoordinatoren – auf Anfrage – bei der Prüfung und Dokumentation von Verlangen auf Auskunft nach dem Informationsfreiheitsgesetz sowie im daran anschließenden Rechtsschutzverfahren; • Formelle Informationserteilung bei Auskunftsbegehren nach dem Informationsfreiheitsgesetz, die in die Zuständigkeit des BMF (Zentralleitung) fallen (Abfertigung des ELAKs mit dem von der inhaltlich zuständigen Abteilung in der ELAK- Stellungnahme beigesteuerten Inhalt; im Falle von Informationen, die im Wege eines Beschaffungsvorganges oder eines sonstigen Vertragsabschlusses entstanden sind, hat die Prüfung und Stellungnahme durch die jeweilige bedarfstragende Organisationseinheit zu erfolgen) • Formelle Erlassung eines abschlägigen Bescheides bei Auskunftsbegehren nach dem Informationsfreiheitsgesetz, die in die Zuständigkeit des BMF (Zentralleitung) fallen (falls erforderlich mit der von der inhaltlich zuständigen Abteilung in der ELAK- Stellungnahme beigesteuerten Begründung; im Falle von Informationen, die im Wege eines Beschaffungsvorganges oder eines sonstigen Vertragsabschlusses entstanden sind, hat die Prüfung und Stellungnahme durch die jeweilige bedarfstragende Organisationseinheit zu erfolgen)
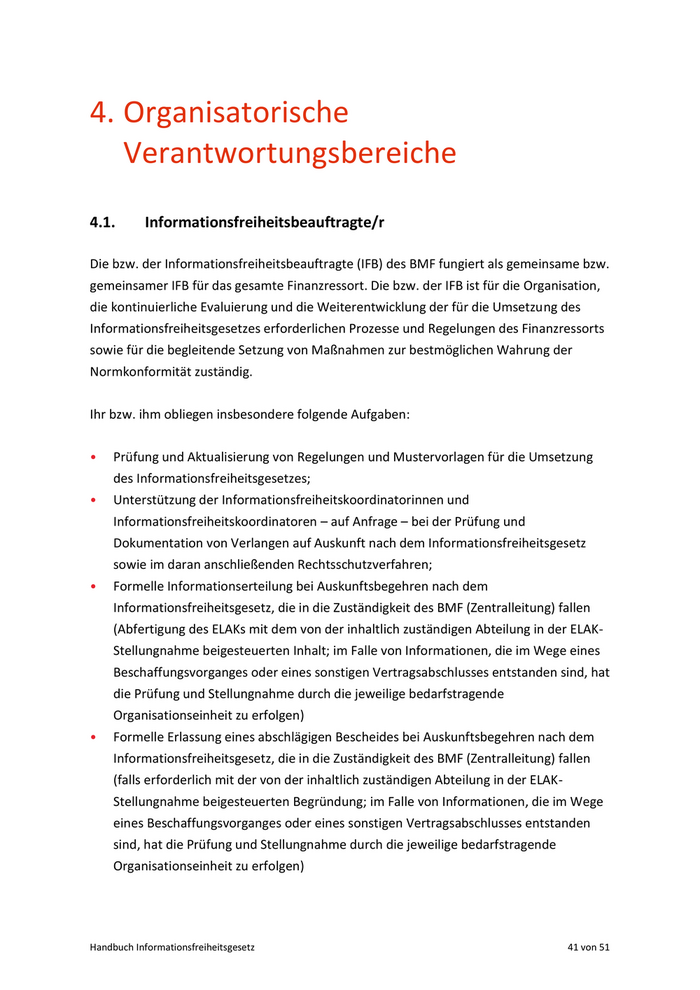
Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 42 von 51 • Formelle Führung eines allenfalls daran anschließenden Rechtsschutzverfahrens (bei inhaltlicher Beteiligung der inhaltlich zuständigen Abteilung; im Falle von Informationen, die im Wege eines Beschaffungsvorganges oder eines sonstigen Vertragsabschlusses entstanden sind, hat die Prüfung und Stellungnahme durch die jeweilige bedarfstragende Organisationseinheit zu erfolgen); • Zusammenarbeit mit der Datenschutzbehörde unter Einbindung des Datenschutzbeauftragten bei Schulungsmaßnahmen gemäß dem Informationsfreiheitsgesetz; • Koordination des Austausches zwischen den Informationsfreiheitskoordinatorinnen und Informationsfreiheitskoordinatoren; • Inhaltliche Ausgestaltung von Schulungsmaßnahmen zur Bearbeitung von Auskunftsverlangen nach dem Informationsfreiheitsgesetz; • Prüfung von Verbesserungsmaßnahmen iZm Prozessen und Regelungen in Vollziehung des Informationsfreiheitsgesetzes; • Laufende Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten. Als IFB fungiert die gemäß der Geschäfts- und Personaleinteilung für die koordinierende Wahrnehmung der Aufgaben des zweiten Teils des Informationsfreiheitsgesetzes zuständige Abteilung Präs. 4. 4.2. Informationsfreiheitskoordinator/innen (IFK) Die Informationsfreiheitskoordinatorinnen und –koordinatoren (IFK) der Sektionen der Zentralleitung, der ˜mter und der (nachgeordneten) Dienststellen fungieren für ihren Organisationsbereich als Anlaufstelle bei Angelegenheiten des Informationsfreiheitsgesetzes und unterstützen die bzw. den IFB bei der Erfüllung ihrer bzw. seiner Aufgaben. Ihr jeweiliger Zuständigkeitsbereich umfasst jene Informationen, die in die Zuständigkeit ihres Organisationsbereiches (Sektion in der Zentralstelle bzw. Amt oder nachgeordnete Dienststelle) fallen. Ihnen obliegen insb. folgende Aufgaben: • Unterstützung der Organisationseinheiten des eigenen Wirkungsbereiches bei der Prüfung von Informationen des eigenen Wirkungsbereiches auf das Bestehen einer
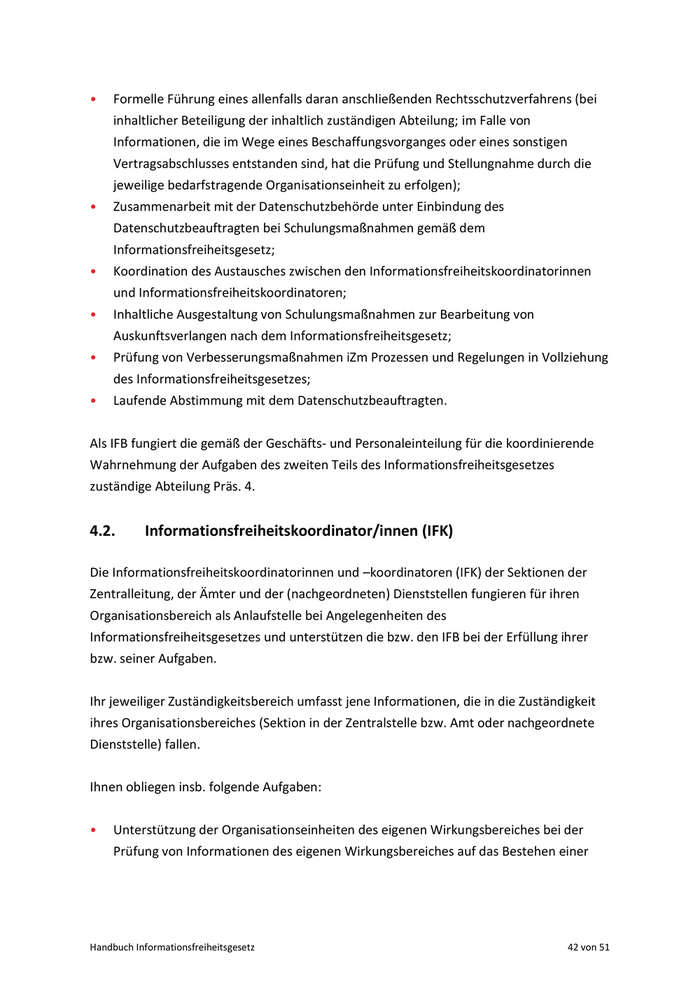
Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 43 von 51 proaktiven Informationspflicht nach den Bestimmungen des Informationsfreiheitsgesetzes • Unterstützung der bzw. des IFB bei der Evaluierung und Setzung von Maßnahmen zur Einhaltung der Bestimmungen des Informationsfreiheitsgesetzes, einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der diesbezüglichen Überprüfungen, jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich; • Laufende Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem IFG in der Zentralleitung bzw. mit den Datenschutzkoordinatoren bzw. den Datenschutzkoordinatorinnen im nachgeordneten Bereich; • IFK der ˜mter und der (nachgeordneten) Dienststellen nehmen darüber hinaus die formale Bearbeitung von Auskunftsbegehren gemäß dem Informationsfreiheitsgesetz einschließlich des Rechtsschutzverfahrens, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, wahr; in der Zentralstelle unterstützen sie den IFB bei diesen Aufgaben. In der Zentralleitung fungieren folgende Kolleginnen und Kollegen für den jeweiligen Bereich als IFK: • IR: Mag.a Kornelia Hacker, MBA • Präs: Mag.a Ulrike Gärtner • S I: MMag.a Maria Gold-Tajalli • S II: Ing. Mag. Oliver Knell und Mag. Gregor Schmied, MA • S III: Magdalena Zeiner, MSc, Katharina Heindl MSc MSc (WU) • S IV: Dr. Martin Vock, LL.M. • S VI: Mag. Sebastian Küssel, Werner Weidlinger, BSc