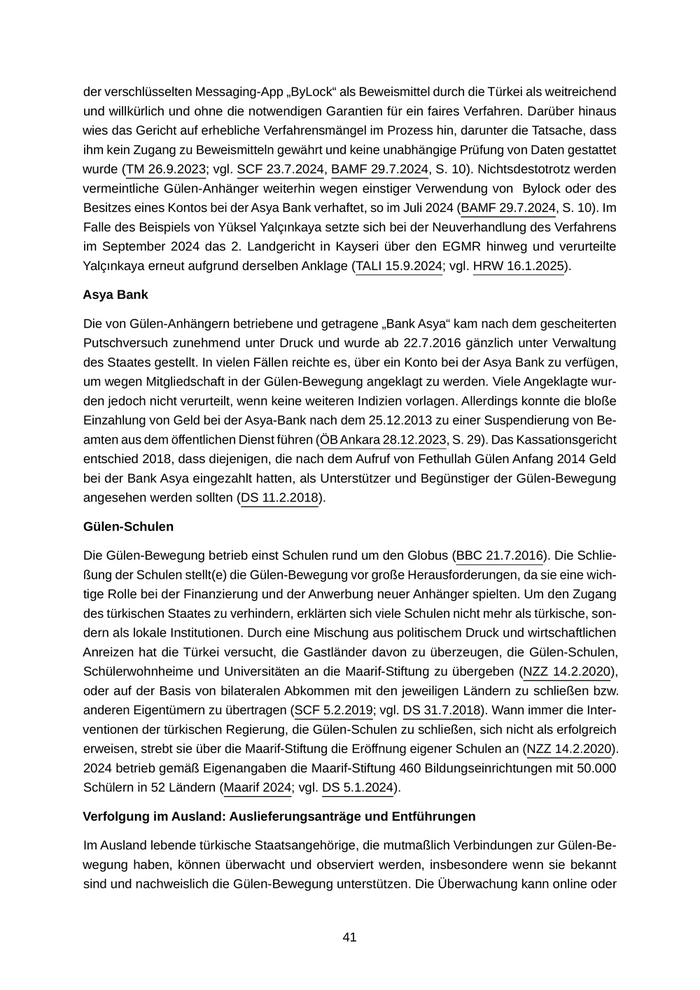2025-09-05-coi-cms-laenderinformationen-tuerkei-version-10-d827
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Länderinformationsblätter“
ByLock, so der Innenminister (DS 19.11.2024; vgl. SCF 19.11.2024). Im Dezember 2024 gab es mehrere Verhaftungswellen: Am 10. Dezember wurden 24 Verdächtige festgenommen. 21 von ihnen sollen 2012 an der Manipulation öffentlicher Personalauswahlprüfungen beteiligt gewesen sein. Ein weiterer Verdächtiger, angeblich der Buchhalter der Stadt Konya, wurde als Nutzer von ByLock verhaftet, während gegen zwei weitere Verdächtige ermittelt wird, weil sie sich in Gülen-Studentenwohnheimen aufhielten und die ByLock-App verwendeten (DS 10.12.2024). Am 18. Dezember wurden laut Innenminister in neun Provinzen 41 vermeintliche Gülen-Mit glieder als Bestandteil eines angeblich geheimen Netzwerkes in der Armee bzw. den Behörden verhaftet, die überdies laufende Verbindungen zu hochrangigen flüchtigen Gülen-Funktionären gehabt hätten (DS 18.12.2024). Und am 24. Dezember wurden 31 Gülen-Verdächtige in der Provinz Izmir festgenommen (DS 24.12.2024). Auch 2025 setzten sich die Verhaftungen von vermeintlichen Gülen-Mitgliedern oder -Unterstützern fort. - Am 7. Jänner wurde berichtet, dass 22 von 37 gesuchten Verdächtigen festgenommen wurden. Sie waren vermeintlich Teil eines Firmennetzwerkes, welches die Gülenbewegung finanziert. Sie wurden laut Behördenangaben durch Aussagen ehemaliger Gülen-Mitglieder, die mit den Behörden zusammengearbeitet haben, sowie durch Finanzermittlungen und Unter suchungen digitaler Beweise, die bei früheren Ermittlungen sichergestellt wurden, identifiziert. Die Verdächtigen hätten über Kuriere Bargeld sowohl an Gülen-Mitglieder, die wegen ihrer Verbindungen zur Gruppe inhaftiert sind, als auch an deren Familien übermittelt (DS 7.1.2025; vgl. SCF 10.1.2025, TM 10.1.2025). Bereits am 10. Jänner verkündete der Innenminister die Verhaftung weiterer 63 Personen bei Operationen in 38 Provinzen (SCF 10.1.2025; vgl. TM 10.1.2025), und am 14.Jänner die Festnahme von weiteren 110 Verdächtigen in 23 Provinzen, welche zum akademischen und militärischen Netzwerk der Gülen-Bewegung gehören sollen (DS 14.1.2025; vgl. SCF 14.1.2025). Bereits am 18. Jänner vermeldete das Innenministerium die Festnahme von 47 Verdächtigen in 23 Provinzen im Rahmen der „ KISKAÇ-35“-Operationen (TC-İB 18.1.2025) und am 24.1.2025 die Festnahme im Zuge der „ KISKAÇ-36“-Operationen von 71 Verdächtigen in 23 Provinzen (TC-İB 24.1.2025; vgl. DS 24.1.2025, SCF 24.1.2025). Am 21.2.2025 verhaftete die Polizei insgesamt 353 Personen, darunter auch zehn Beamte, die verdächtigt werden, der Gülen-Bewegung anzugehören. Die Verdächtigen wurden bei Razzien in 31 Städten festgenommen. Ihnen wird laut Innenminister vorgeworfen, eine Dö ner-Kebab-Restaurantkette benutzt zu haben, um Geld für die Gülenbewegung zu sammeln (DS 21.2.2025; vgl. SCF 21.2.2025, C8 22.2.2025). Bei Operationen zwischen dem 19. und 27. März in 27 Provinzen wurden 73 Personen festgenommen. Hiervon wurden 48 inhaftiert, 16 unter richterlicher Aufsicht freigelassen und gegen den Rest wurde weiter ermittelt. In nenminister Yerlikaya sagte, die Festgenommenen stünden im Verdacht, über Münztelefone Kontakt zu halten, die verschlüsselte Nachrichten-App ByLock zu benutzen und Inhalte der Gülen-Bewegung in sozialen Medien zu verbreiten. Einige Personen wurden auch beschuldigt, Teil der angeblichen „ militärischen und aktuellen Strukturen“ der Gülen-Bewegung zu sein oder sie finanziell zu unterstützen (TM 4.4.2025; vgl. TC-İB 4.4.2025). Am 5. Mai verkündete die Polizei von Ankara die Verhaftung von 33 vermeintlichen Gülenisten, wovon 20 in öffentlichen Einrichtungen arbeiteten. Die Verdächtigen sollen für die Rekrutierung neuer Mitglieder und die Überprüfung deren Loyalität zuständig gewesen sein (DS 5.5.2025; vgl. Hürriyet 5.5.2025). In 32
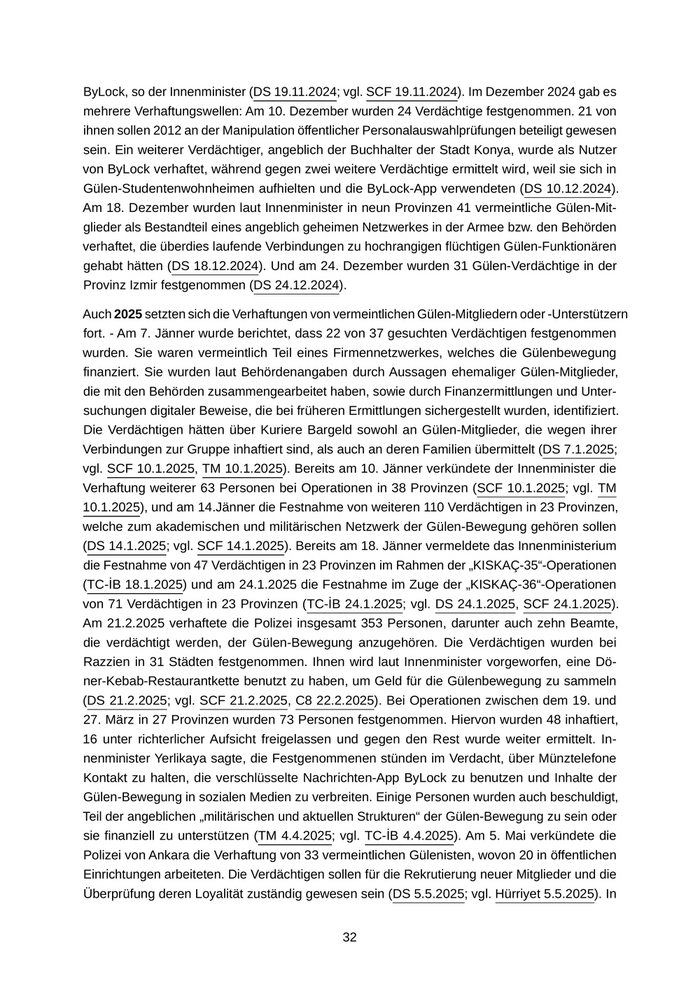
der ersten Mai-Hälfte wurden in weiteren Operationen in 47 Provinzen, vor allem in Gaziantep, 225 Verdächtige festgenommen. Am 10.5.2025 wurden vier weitere vermeintliche Gülen-Mit glieder verhaftet, wobei die Behörden behaupteten, dass es sich um eine Gruppe handle, die Reisen von jungen Türken in Länder des Balkans (Albanien, Nordmazedonien, Bosnien und Montenegro) organisiere, wo diese in Kursen indoktriniert und rekrutiert würden (DS 11.5.2025; vgl. TR-Today 11.5.2025, TC-İB 6.5.2025). Bereits am 16.5.2025 gab das Innenministerium die Verhaftung weiterer 101 Personen bei Razzien in 27 Provinzen bekannt. Den Inhaftierten wurde vorgeworfen, über Münztelefone Kontakt zu Mitgliedern der Bewegung aufgenommen, die Bewegung finanziell unterstützt und Propaganda in sozialen Medien verbreitet zu haben (TC-İB 16.5.2025; vgl. SCF 16.5.2025). Und am 23.05.2025 wurden zeitgleich in 36 Provin zen Razzien gegen mutmaßliche Angehörige der Gülen-Bewegung durchgeführt, wobei 56 Militärangehörige in Untersuchungshaft genommen wurden (BAMF 26.5.2025, S. 9; vgl. DS 23.5.2025). Und Mitte Juni wurd innerhalb von zwei Tage 56 Personen festgenommen, wobei der Fokus auf die Zerschlagung der laut Behördenangaben geheimen Infrastruktur der Bewegung, ihrer Rekrutierungsbemühungen unter Jugendlichen und ihrer Fluchthelferringe, die illegale Grenzübertritte ermöglichten, gelegt wurde (SCF 17.6.2025). In der zweiten Junihälfte erfolgte eine größere Verhaftungswelle, bei der fast 250 Personen in über 40 Provinzen festgenommen wurden, darunter 163 aktive Militärangehörige inklusive mehreren Offizieren sowie 21 aktive und ehemalige Polizisten (SCF 24.6.2025; vgl. BIRN 24.6.2025, TM 24.6.2025). Gefahren für Rechtsvertreter Anwälte von angeblichen Gülen-Mitgliedern laufen Gefahr, selbst in den Verdacht zu gera ten, Verbindungen zur Gülen-Bewegung zu haben (MBZ 18.3.2021, S. 40f.). Im September 2020 wurden 47 Rechtsanwälte festgenommen, weil diese angeblich durch ihre Rechtsbera tung Gülen-Mitglieder unterstützt hätten (AlMon 16.9.2020; vgl. ICJ 14.9.2020). Siehe auch Kapitel:Rechtsstaatlichkeit / Justizwesen. Verfolgung von Nicht-Gülen-Mitgliedern als Gülenisten Mitunter werden „ Nicht-Gülenisten“ als Gülen-Mitglieder oder -Anhänger gebrandmarkt und von den Behörden als solche behandelt. In diesem Fall könnten beispielsweise Oppositionelle, Ge werkschaftsaktivisten, Journalisten und Akademiker, die sich kritisch über Regierung äußern, in Betracht kommen (MBZ 2.2025a, S. 50). Beispielsweise wurde die Anwältin Dilek Ekmek çi strafrechtlich verfolgt und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung in Untersuchungshaft genommen. Sie hatte sich u. a. kritisch über den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen in staatlichen Einrichtungen geäußert (MBZ 2.2025a, S. 50; vgl. MLSA 24.10.2024, Agos 31.1.2025). Ende Jänner 2025 entschied das Gericht die Freilassung von Ekmekçi nach 152 Tagen Haft. Sie wurde jedoch wegen „ wissentlicher und vorsätzlicher Unter stützung einer illegalen Organisation“ zu einem Jahr und 13 Monaten verurteilt und mit einer Ausreisesperre belegt (MLSA 31.1.2025; vgl. Agos 31.1.2025). Kriterien für die Verfolgung durch die Justiz 33
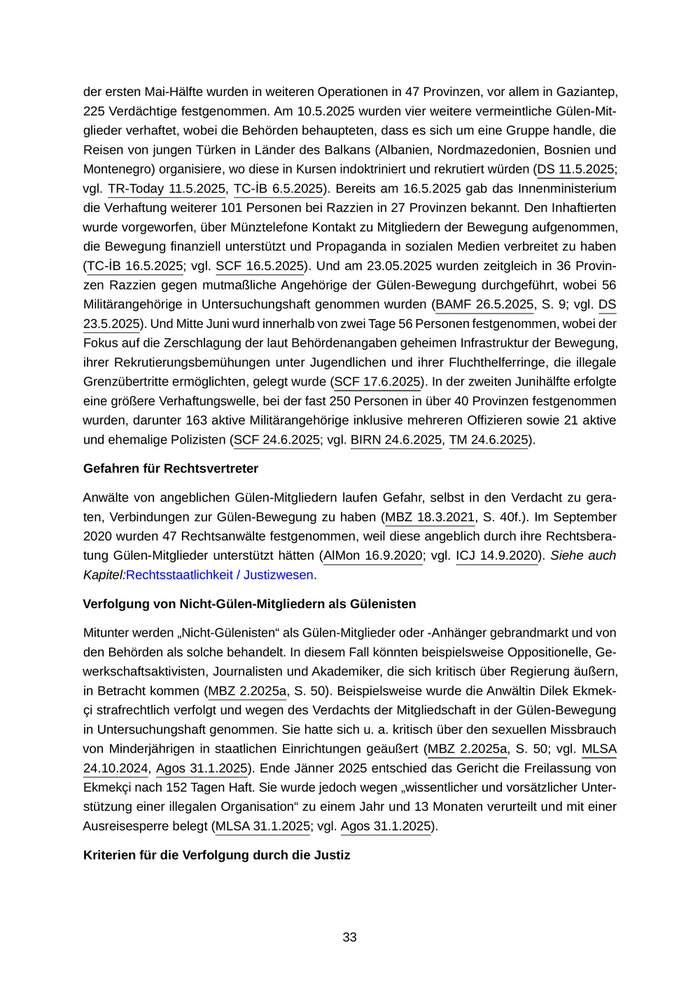
Menschenrechtsbeobachter haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass die türkische Regierung keine klaren Kriterien veröffentlicht hat, anhand derer Personen mit der Gülen-Bewegung in Verbindung gebracht werden können (DFAT 16.5.2025, S. 20; vgl. AA 20.5.2024). - Bereits am 3.9.2016 veröffentlichte die Tageszeitung Milliyet eine nicht erschöp fende „ Liste von sechzehn Kriterien“, die als Richtschnur für die Entlassung aus staatlichen Funktionen und für die Strafverfolgung dient. Personen, welche die angeführten Kriterien in unterschiedlichem Maße erfüllen, werden offiziellen Verfahren unterzogen und als „Terroristen“ bezeichnet - gefolgt von ihrer Festnahme oder Inhaftierung. Nach Angaben der Regierung war das Ziel der Erstellung einer solchen Liste, „ die Schuldigen von den Unschuldigen zu unterschei den“ (JWF 1.1.2019, S. 10). In der Regel reicht das Vorliegen eines der folgenden Kriterien, um eine strafrechtliche Verfolgung als mutmaßlicher Gülenist einzuleiten: Das Nutzen der verschlüs selten Kommunikations-App „ ByLock“; Geldeinlagen bei der Bank Asya nach dem 25.12.2013 (bis zu deren Schließung 2016) oder anderen Finanzinstituten der sogenannten „ parallelen Struktur“; Abonnement bei der Nachrichtenagentur Cihan oder der Zeitung Zaman; Spenden an Gülen-Strukturen zugeordnete Wohltätigkeitsorganisationen (AA 20.5.2024, S. 6f.; vgl. MBZ 2.3.2022, S. 38, JWF 1.1.2019, S.11, Statewatch/Turkut/Yıldız 11.2021, S. 10f.), wie der einst größten Hilfsorganisation des Landes „ Kimse Yok Mu“ (JWF 1.1.2019, S.11); der Besuch der eigenen Kinder von Schulen, die der Gülen-Bewegung zugeordnet werden; Kontakte zu Gülen zugeordneten Gruppen/Organisationen/Firmen, inklusive Beschäftigungsverhältnisse und die Teilnahme an religiösen Versammlungen der Gülen-Bewegung (AA 20.5.2024, S. 7; vgl. JWF 1.1.2019, S. 11, Statewatch/Turkut/Yıldız 11.2021, S. 10f.). Weitere Kriterien sind u. a.: die Unter stützung der Gülen-Bewegung in Sozialen Medien, der mehrmalige Besuch von Internetseiten der Gülen-Bewegung und die Nennung durch glaubwürdige Zeugenaussagen, Geständnisse Dritter oder schlicht infolge von Denunziationen (JWF 1.1.2019, S. 11; vgl. Statewatch/Turkut/ Yıldız 11.2021, S. 10f.). Eine Verurteilung setzt in der Regel das Zusammentreffen mehrerer dieser Indizien voraus, wobei der Kassationsgerichtshof präzisiert hat, dass für die Mitglied schaft in einer bewaffneten Terrororganisation ein gewisser Bindungsgrad der Person an die Organisation nachgewiesen werden muss (AA 20.5.2024, S. 7). Der Kassationsgerichtshof ent schied im Mai 2019, dass weder das Zeitungsabonnement eines Angeklagten (SCF 6.8.2019) noch die Einschreibung seines Kindes in einer Gülen-Schule für eine Verurteilung ausreicht (AA 20.5.2024, S. 7; vgl. SCF 6.8.2019). Siehe zu den Kriterien weiter unten das Urteil des EGMR vom 3.12.2024 als Beispiel! Laut Eigenangaben differenzieren die türkischen Behörden unterschiedliche Schweregrade der Beteiligung an der Gülen-Bewegung. Im März 2020 erklärte die 16. Strafkammer des Ver fassungsgerichts, zuständig für Berufungen in allen Gülen-Fällen, dass es sieben Stufen der Beteiligung gäbe: Die erste Ebene besteht aus den Menschen, welche die Gülen-Bewegung aus guter Absicht (finanziell) unterstützten. Die zweite Schicht besteht aus einer loyalen Gruppe von Menschen, die in Gülen-Organisationen arbeiteten und mit der Ideologie der Gülen-Be wegung vertraut war. Die dritte Gruppe besteht aus Ideologen, die sich die Gülen-Ideologie zu eigen machten und in ihrem Umfeld verbreiteten. Die vierte Gruppe waren Inspektoren, die die verschiedenen Formen von Dienstleistungen der Gülen-Bewegung überwachten. Die fünfte Gruppe setzte sich aus Beamten zusammen, die für die Erstellung und Umsetzung der Politik 34
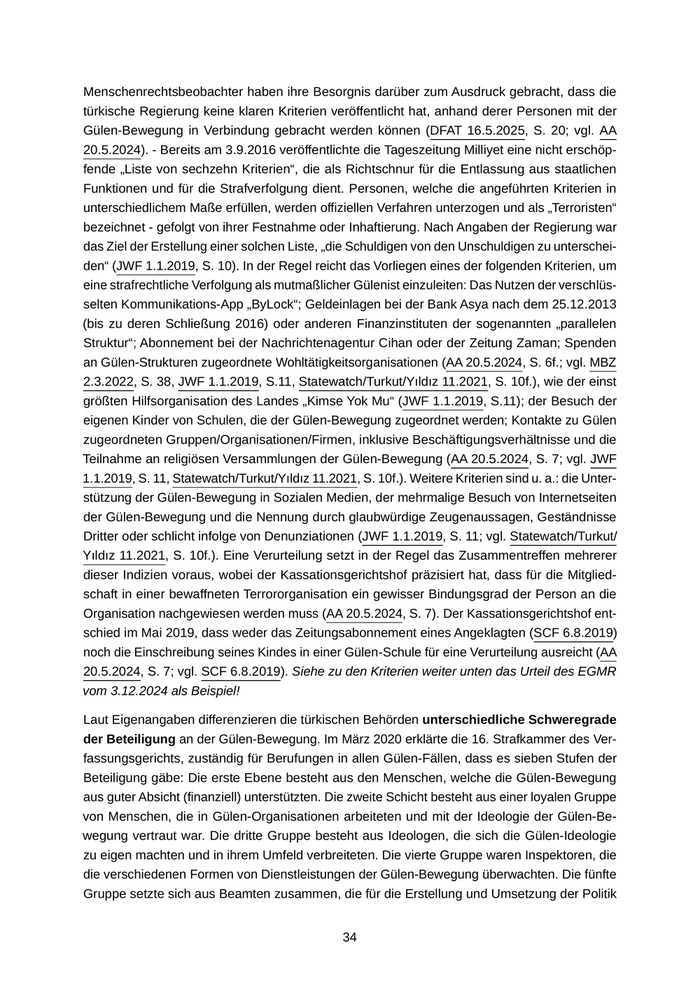
der Gülen-Bewegung verantwortlich war. Die sechste Gruppe bildet den elitären Kreis, der den Kontakt zwischen den verschiedenen Segmenten der Organisation aufrechterhielt bzw. dies immer noch tut, aber auch Personen aus ihren Positionen entlassen konnte. Die siebte Gruppe besteht aus siebzehn Personen, die direkt von Fethullah Gülen ausgewählt wurden und an der Spitze der Gülen-Bewegung stehen (MBZ 18.3.2021, S. 38f.). Während praktisch jeder mit einem Gülen-Hintergrund strafrechtlich belangt werden kann, stehen mutmaßliche Gülenisten im Sicherheitsapparat, wie Militärs und Gendarme, besonders im Visier. Auch Personen, die Führungspositionen in Gülen-Institutionen wie den Gülen-Schulen, der Fatih-Universität in Is tanbul und der Tageszeitung Zaman innehatten, fallen den Behörden eher negativ auf (MBZ 2.3.2022, S. 38). Die Entscheidung der türkischen Behörden, vermeintliche Gülen-Mitglieder strafrechtlich zu verfolgen, oder nicht, scheint sehr willkürlich zu sein (MBZ 2.3.2022, S. 39). Moderate Rich ter tendieren zwischen „ passiven“ und „ aktiven“ Gülen-Mitgliedern zu unterschieden, während Hardliner keine Unterscheidung hinsichtlich der Kriterien einer vermeintlichen Unterstützung oder Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung machen. Infolgedessen ist der Ausgang der Straf verfahren, insbesondere hinsichtlich des Strafausmaßes, willkürlich (MBZ 18.3.2021, S. 41). Zu dieser Unberechenbarkeit trägt u. a. der Umstand bei, dass die Behörden weder objektive Krite rien verwenden, noch sie diese konsequent anwenden (MBZ 2.3.2022, S. 39). Selbst Personen, die keine Gülenisten waren, wie Oppositionspolitiker, Menschenrechtsaktivisten und linke Ge werkschaftsmitglieder, wurden beschuldigt, Verbindungen zur Gülen-Bewegung zu haben (MBZ 31.8.2023, S. 43). Anlässlich des Todes von Fethullah Gülen am 20.10.2024 wurden Personen, die öffentlich ihr Beileid zum Ausdruck brachten strafrechtlich wegen Terrorismusunterstützung verfolgt. So wur de der Chefredakteur der Zeitung Yeni Asya, Kazım Güleçyüz, wegen einer diesbezüglichen Beileidsbekundung auf der Plattform „ X“ mit den Worten: „Allah habe ihn selig“ festgenom men (DTJ 28.10.2024; vgl. NaT 24.10.2024). Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft ordnete die Verhaftung von insgesamt 15 Verdächtigen an, von denen tatsächlich vier festgenommen wurden, weil sie Gülen in sozialen Medien nach seinem angeblichen Tod gelobt hatten (NaT 24.10.2024). Die Verwandten von hochrangigen Gülenisten sind besonders gefährdet, die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zu ziehen (MBZ 2.2025a, S.52). So wurde nebst Selahaddin Gülen, ein Neffe Fetullah Gülens, der bereits 2021 vom Nationale Nachrichtendienst MİT von Kenia in die Türkei verbracht wurde, auch Asiye Gülen, eine Nichte Fetullah Gülens, und deren Ehemann im Juni 2023 in Istanbul festgenommen (MBZ 31.8.2023, S.45). Und Mitte Juli 2023 verhafte ten die Istanbuler Polizei und der Geheimdienst MİT Selman Gülen, einen weiteren behördlich gesuchten Neffen Fetullah Gülens, die Frau des Ersteren, Nur Gülen, sowie deren Eltern (DS 14.7.2023). Generell sind Familienangehörige mutmaßlicher Gülen-Anhänger betroffen gewe sen, unter anderem durch Reiseverbote und/oder Passbeschlagnahmungen, das Einfrieren von Vermögenswerten und die Entlassung aus dem öffentlichen Dienst (DFAT 16.5.2025, S. 21). Es 35
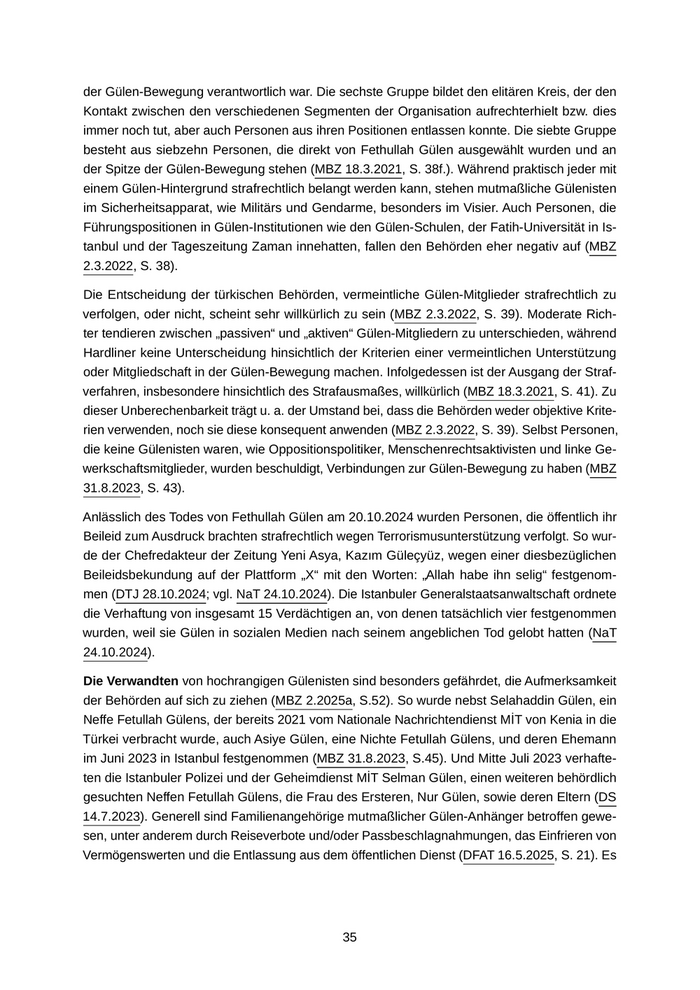
gab jedoch auch mehrere Fälle von Familien, die einen Gülen-Unterstützer in ihren Reihen hat ten, ohne dass die Angehörigen Probleme mit den türkischen Behörden hatten (MBZ 2.3.2022, S. 41). Die Strafverfolgungsbehörden wenden zur Identifizierung vermeintlicher Gülen-Mitglieder eine Überwachungs-Software an, die anhand von 78 Haupt- und 253 Sekundärkriterien Verdäch tigte ausfindig macht, das sog. „ FETÖ-Meter“ (TM 5.3.2021). Diese Kriterien sind in vier Kate gorien gruppiert, nämlich: jene, die unmittelbar den Kernbereich des Privatlebens der profilierten Person betreffen; diejenigen, die sich auf das Berufsleben (ab der Kadettenzeit) der Person be ziehen; diejenigen, die sich auf das soziale Umfeld und die Zugehörigkeit der profilierten Person beziehen; diejenigen, die sich auf die Verwandten der profilierten Person beziehen (Statewatch/ Turkut/Yıldız 11.2021). Zu den Kritierien gehören etwa Daten über den Bildungswerdegang, die Verwandtschaft und den Vermögensstand. Verdächtige Merkmale sind beispielsweise der Dienst in einer NATO-Vertretung im Ausland oder ein Doktorat. Bei Militärangehörigen gilt die eigene Hochzeit außerhalb von Gebäuden im Besitz des Militärs als Verdachtsmoment, weil unterstellt wird, dass dies der Verschleierung der Identitäten der Hochzeitsgäste diente (TM 5.3.2021). Das FETÖ-Meter sammelte zu Beginn insbesondere nachrichtendienstliche Daten aus allen Berei chen der Armee sowie aus Ministerien und Behörden, um mögliche, aus der Sicht der Behörden, Infiltratoren aufzuspüren. Die Ermittler untersuchten mit dem Tool u. a. etwa eine Million Han dynummern, die auf ehemalige und noch dienende Marineoffiziere registriert waren und fanden angeblich heraus, dass 1.500 von ihnen Nutzer der verschlüsselten Messenger-App „ ByLock“ waren. Ebenso wurden die Kontoinformationen von Offizieren bei der inzwischen aufgelösten Bank Asya zur Identifizierung verwendet (DS 12.9.2018). Der FETÖ-Meter inspirierte auch an dere staatliche Stellen zu einer ähnlichen Politik, wie die Sozialversicherungsanstalt (SGK), die seit vier Jahren mutmaßliche Gülen-Sympathisanten in ihrer Datenbank mit dem „ Code 36“ kennzeichnet. Die Kennzeichnung ist automatisch für jeden potenziellen Arbeitgeber sichtbar, was zu Befürchtungen bei denjenigen führt, die erwägen, eine dieser Personen einzustellen (TM 5.3.2021; vgl. DFAT 16.5.2025, S. 21). Die Entlassenen verlieren ihr Einkommen und ihre Sozialleistungen, darunter auch den Zugang zu Krankenversicherung und Pensionsleistungen (DFAT 16.5.2025, S. 21). Es ist ein soziales Stigma, ein Gülen-Mitglied zu sein, weshalb sich viele Bürger von ihnen distanzieren, und Bekannte innerhalb des sozialen Umfeldes von Gülen-Mitgliedern brechen die Kontakte ab (MBZ 31.8.2023, S. 44f.). Diese Haltung beruht nicht immer auf Hass und Ab neigung, sondern ist eine Form des Selbstschutzes, aus Angst strafrechtlich verfolgt zu werden, wenn sie mit Personen der Gülen-Bewegung in Verbindung gebracht werden (MBZ 2.3.2022, S. 41). Infolgedessen haben vermeintliche oder tatsächliche Gülen-Mitglieder auch ihren Ar beitsplatz verloren oder fanden keine (neue) Anstellung (MBZ 31.8.2023, S. 46). Auch das „ FETÖ-Meter“ wurde als Instrument, vor allem in der Armee, eingesetzt, um Personen zu entlas sen. Zu Entlassungen kam es selbst aufgrund einer Verwandtschaft (Ehepartners, Geschwister) mit einem angeblichen Gülen-Mitglied, das z. B. ein Konto bei der Asya Bank hatte oder ein angeblicher ByLock-Benützer war (Statewatch/Turkut/Yıldız 11.2021, S. 21-26). In der amtli chen Kundmachung vom März 2022 wurde bereits klargestellt, dass alle Personen, die wegen 36
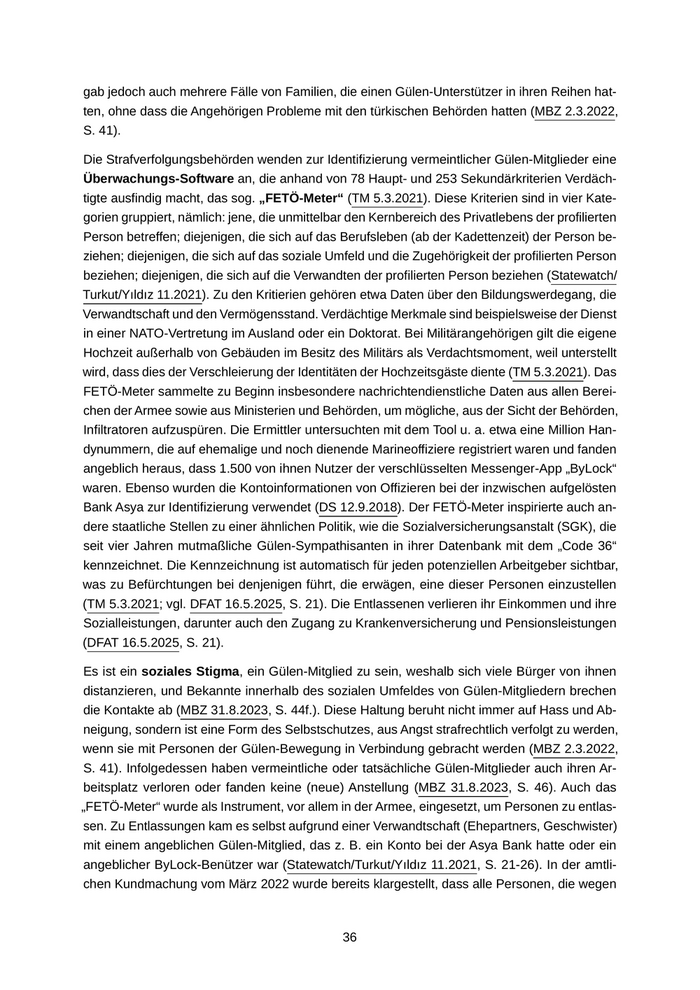
(angeblicher) Verbindungen zum Terrorismus zwangsweise entlassen worden waren, in einer Datenbank der Sozialversicherung, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erfasst wurden. Diese Re gistrierung erschwerte es entlassenen Mitarbeitern, eine neue Stelle zu finden. Wenn sie sich auf eine neue Stelle bewarben, konnten potenzielle Arbeitgeber sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor die Registrierung über ein SGK-Portal einsehen. Sie waren oft nicht geneigt, Personen mit einer solchen Registrierung einzustellen (MBZ 2.2025a, S. 51f.). Es gab in der Vergangenheit Berichte, wonach arbeitslose Gülen-Mitglieder zur Schattenwirtschaft auf der Straße oder zu einem Leben als Selbstversorger im Dorf ihrer Vorfahren verdammt sind (MBZ 18.3.2021, S. 43). Urteile des EGMR und der türkischen Höchstgerichte Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat am 23.11.2021 ein Urteil zu 427 türkischen Richtern und Staatsanwälten gefällt, darunter Mitglieder des Kassationsge richtshofs und des Staatsrates [oberstes Verwaltungsgericht], die wegen des Verdachtes der Zugehörigkeit zur Gülen-Bewegung aus dem Staatsdienst entlassen und festgenommen wor den waren. Gemäß EGMR-Urteil war deren Inhaftierung willkürlich und damit rechtswidrig. Die Türkei wurde deshalb zu Schadensersatzzahlungen von 5.000 EUR pro Person verurteilt. Im Verfahren ging es vor allem um die Frage, ob die besagten Vertreter der Justiz überhaupt in Untersuchungshaft genommen werden durften, da das türkische Recht dies für die Mitglieder der Justiz nicht erlaubt, mit Ausnahme bei unmittelbarer Verübung einer Straftat, worauf sich die türkische Regierung berief. Diese Begründung wies der EGMR als abwegig zurück, da die Mitgliedschaft in einer Organisation keine „ in flagranti“-Tat sein könne (BAMF 6.12.2021, S. 14). Und Anfang September 2022 entschied der EGMR, dass die Untersuchungshaft von 230 Rich tern und Staatsanwälten nach dem gescheiterten Putsch 2016 rechtswidrig war und dass die Türkei jedem Antragsteller 5.000 Euro Schadenersatz zahlen muss. Bei 209 Beschwerdeführern habe die Untersuchungshaft nicht in einem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren stattgefun den, während bei den übrigen 21 Klägern die Verdachtsmomente keine Begründung für die Verhängung einer Untersuchungshaft konstituierten (TM 6.9.2022). Am 25.6.2024 entschied der EGMR (Duymaz und andere gegen die Türkei), dass für die Unter suchungshaft von 314 Personen nach dem gescheiterten Putsch im Juli 2016 gegen Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstieß, da keine Gründe vorlagen, die einen hinrei chenden Verdacht begründen konnten, dass die Betroffenen eine Straftat begangen hätten. Der EGMR erklärte auf der Grundlage der Gerichtsdokumente, dass die Mehrheit der Antragsteller als Nutzer der Messaging-App ByLock identifiziert wurde. Einige wurden aufgrund von Zeugen aussagen oder Konten bei der Gülen-nahen Bank Asya verdächtigt, mit der Gülen-Bewegung in Verbindung zu stehen, und einige aufgrund des Besitzes von Gülen-nahen Publikationen und/oder US-Ein-Dollar-Scheinen mit einer „ F“-Seriennummer die den Anfangsbuchstaben des Vornamens „ Fetullah“ bezeichnet, während andere aufgrund ihrer Beschäftigung bei und/oder Mitgliedschaft in Gülen-nahen Einrichtungen und Organisationen verdächtigt wurden. Der EGMR hat jedoch mehrmals klargestellt, dass solche Aktivitäten bzw. Umstände nicht ausreichen, um zu beweisen, dass jemand ein Verbrechen begangen hat. - Das Gericht verurteilte Ankara zudem 37
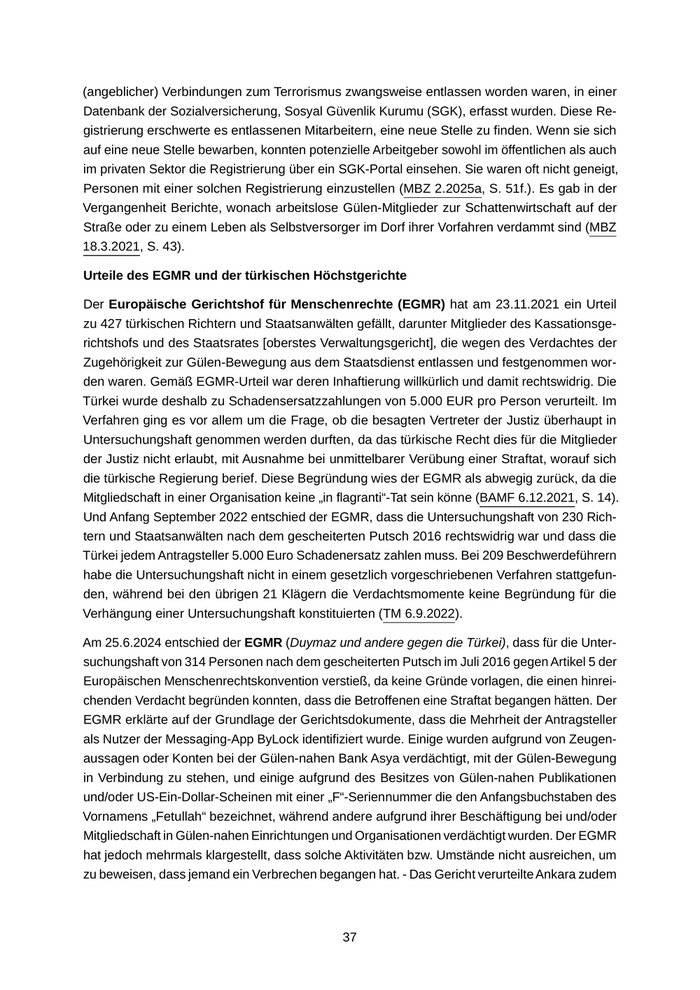
zur Zahlung von 5.000 Euro Schadenersatz sowie von Kosten und Auslagen (TM 25.6.2024; vgl. ECHR 25.6.2024). Der EGMR verurteilte am 3.12.2024 in zwei getrennten Sammelurteilen (Kesler und andere vs. die Türkei / Sert und andere vs. die Türkei) erneut wegen der Verhaftung und Untersu chungshaft von insgesamt 379 Personen nach einem gescheiterten Putschversuch im Jahr 2016 wegen ihrer angeblichen Verbindungen zur Gülen-Bewegung. Der EGMR sah keine aus reichenden Gründe für ihre Inhaftierung vorliegen. Den Klägern wurde die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, weil sie die ByLock-Messanger-App nutzten, Konten bei der Bank Asya unterhielten, Gülen-bezogene Publikationen und US-Ein-Dollar-Scheine mit einer Seriennummer „ F“ (angeblich für „ Fethullah“) und/oder ihre Beschäftigung bei und/oder Mitgliedschaft in Institutionen und Organisationen, die alle von der türkischen Regierung als mit der Gülen-Bewegung verbunden angesehen werden. Darüber hinaus wurden Zeugenaussagen, die auf Verbindungen zur Bewegung hinweisen, Social-Media-Beiträge, die Teilnahme an oder die Abhaltung religiöser Versammlungen, die Kommunikation mit leitenden Führungskräften der Gülen-Bewegung, die Erleichterung der Kommunikation zwischen Gülen-Mitgliedern, der Aufenthalt in Gülen-nahen Häusern und die Durchführung verschiedener anderer Aktivitäten auf mutmaßlichen Befehl der Bewegung von den türkischen Gerichten auch als strafrechtliche Be weise gegen die Antragsteller verwendet. Das EGMR entschied, dass die Türkei gegen Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstieß, da es in den Fällen aller 379 Kläger keine ausreichenden Gründe für die Anordnung und Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft gab. Das EGMR entschied, dass die Türkei 363 der 379 Kläger jeweils 5.000 Euro als Ent schädigung für immaterielle Schäden sowie für Kosten und Auslagen zahlen muss. - Mit der jüngsten Entscheidung hat der EGMR festgestellt, dass die Türkei die Rechte von insgesamt 2.732 Personen in 62 verschiedenen Anträgen im Zusammenhang mit den Rechtsverletzun gen nach dem Putschversuch verletzt hat. Die Türkei wurde in diesen Fällen zur Zahlung von insgesamt 12.563.538 Euro an immateriellen Schäden und Kosten verurteilt (TM 3.12.2024; vgl. ECHR 3.12.2024a, ECHR 3.12.2024b). Der EGMR entschied am 11.2.2025, dass die Türkei in drei verschiedenen Fällen das Recht von 120 Richtern und Staatsanwälten auf ein faires Verfahren verletzt hat. Die Urteile – Olcay und andere vs. die Türkei, Benli und andere vs. die Türkei - der Fall Benli betraf sechs Richter und leitende Inspektoren des Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte (HSYK) und des Justizministeriums - sowie Tosun und andere vs. die Türkei – betrafen die Amtsenthebungen von Richtern sowohl vor als auch nach dem Putschversuch im Jahr 2016. Den betroffenen Richtern wurde kein Rechtsweg zur Anfechtung ihrer Entlassung ermöglicht, was sie dazu veranlasste, ihren Fall vor den EGMR zu bringen. Der EGMR entschied einstimmig, dass die Richter einen legitimen Anspruch darauf hatten, ihre Entlassung anzufechten, und dass die Verweigerung einer gerichtlichen Überprüfung ihre Grundrechte beeinträchtigte und gegen Artikel 6 § 1 (Recht auf Zugang zu einem Gericht) verstieß. Das Gericht verurteilte die Türkei, jedem Antragsteller 3.000 Euro Schadenersatz zu zahlen (TM 11.2.2025; vgl. Politurco 11.2.2025). 38
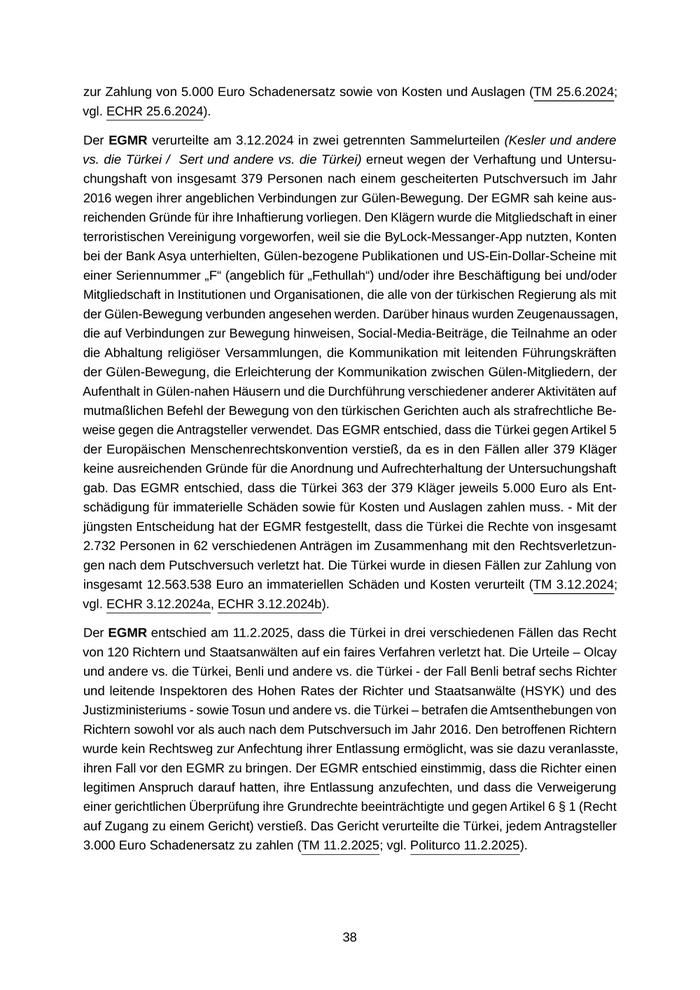
Das Kassationsgericht (i. e. Oberstes Appellationsgericht) sprach am 21.6.2022, sechs Jahre nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei, 71 ehemalige Militärschüler frei, die wegen Be teiligung am Umsturzversuch zu lebenslanger Haft verurteilt worden waren (Spiegel 23.6.2022; vgl. Bianet 22.6.2022). Im Februar 2024 beschloss der Staatsrat (Verwaltungsgerichtshof), dass 450 Richter und Staatsanwälte, die seinerzeit zwangsweise entlassen worden waren, wieder eingestellt werden sollten. Präsident Erdoğan äußerte öffentlich seinen Unmut darüber und bezeichnete die Ent scheidung des obersten Verwaltungsgerichtes als „ inakzeptabel“. Nach dieser Entscheidung leitete der Rat der Richter und Staatsanwälte (HSK) eine neue Untersuchung gegen 387 Richter und Staatsanwälte ein (HDN 19.2.2024; vgl. MBZ 2.2025a, S. 51). Das Verfassungsgericht ordnete am 22.01.2025 per Beschluss die Wiederaufnahme des Ver fahrens gegen den ehemaligen Lehrer Hasan Sarıcı an, der nach dem Putschversuch im Jahr 2016 per Regierungserlass aus seinem Amt entlassen und wegen Mitgliedschaft in der Gü len-Bewegung zu sechs Jahren Haft verurteilt worden war. Die Verurteilung Sarıcıs vor dem Ersten Hohen Strafgerichtshof in Kırklareli basierte auf seiner Mitgliedschaft in einer Gülen-na hen Gewerkschaft, Finanztransaktionen bei der Bank Asya und einem Abonnement der Zeitung Zaman. Als Begründung für die Wiederaufnahmeanordnung führte das Höchstgericht Verstöße gegen Verfassungsrechte und unzureichende Beweise an. Nebst der Feststellung von Verfah renslücken betonte das Verfassungsgericht, dass Sarıcıs angebliche Aktivitäten zum Zeitpunkt seiner Verurteilung kein Verbrechen darstellten. Das Gericht konnte demnach keinen direkten Zusammenhang zwischen Sarıcıs Handlungen und einer mutmaßlichen aktiven Teilnahme an kriminellen Aktivitäten herstellen. Das Verfassungsgericht betonte, dass für die strafrechtliche Verantwortlichkeit klare Beweise für Vorsatz und aktive Teilnahme an organisatorischen Aktivi täten erforderlich seien (BAMF 3.2.2025, S. 9; vgl. SCF 22.1.2025). In der Begründung stellte das Höchstgericht fest, dass es keine konkreten Beweise dafür gab, ob der Antragsteller wusste, dass die Gülen-Bewegung eine terroristische Organisation war, bevor sie als solche eingestuft wurde, das heißt, dass Sarıcı vernünftigerweise nicht vorhersehen konnte, dass er strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden würde (YŞ 23.1.2025). ByLock und spezielle Münztelefone ByLock ist eine Handy-Applikation zur verschlüsselten, sicheren Austausch schriftlicher und gesprochener Nachrichten. Sie wird von der türkischen Regierung als eines der wichtigsten In dizien für eine Unterstützung bzw. Nähe zur Gülen-Bewegung betrachtet. Zudem sei ByLock laut Behörden von der Gülen-Bewegung verwendet worden, um den Putschversuch vom Juli 2016 vorzubereiten (BAMF 4.11.2024b, S. 6). Im September 2017 entschied das Kassationsgericht, dass der Besitz von ByLock einen ausreichenden Nachweis darstellt, um die Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung festzustellen. Mehrere Personen, die wegen angeblicher Nutzung von By Lock verhaftet wurden, wurden freigelassen, nachdem im Dezember 2017 nachgewiesen wurde, dass Hunderte von Personen zu Unrecht der Nutzung der mobilen Anwendung beschuldigt wur den (EC 17.4.2018, S. 8). Trotzdem urteilte das Verfassungsgericht im Juni 2020 anlässlich eines Beschwerdeverfahrens, dass die Benutzung von ByLock als ausreichender Beweis für 39
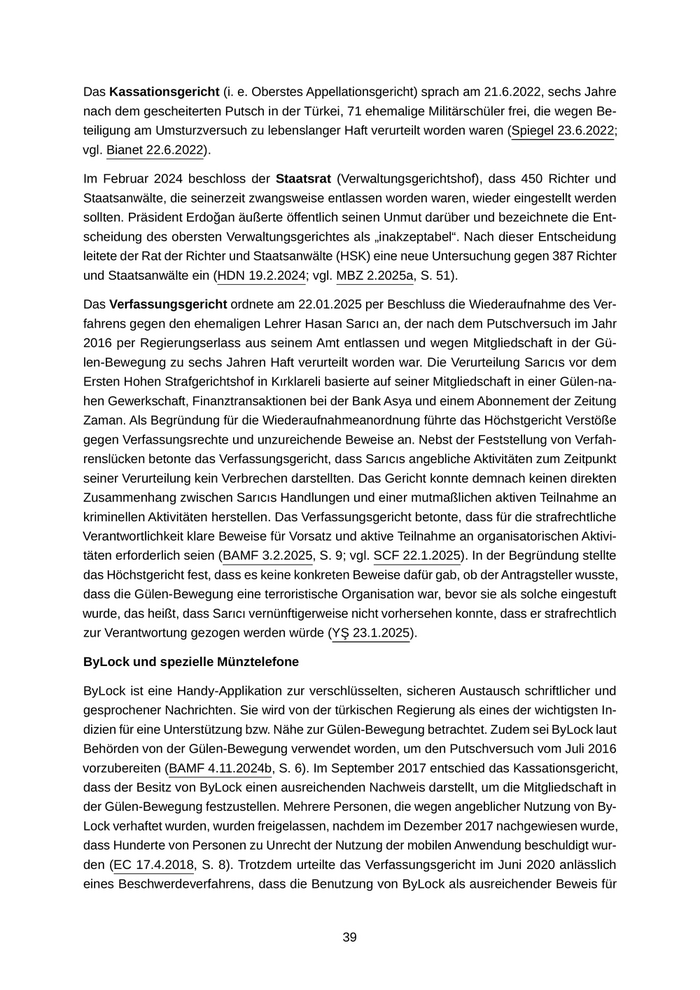
die Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung gilt (Ahval 27.6.2020; vgl. BAMF 4.11.2024b, S. 6). Allerdings hatte die Generalversammlung des Verfassungsgerichts zuvor in seiner Entscheidung vom 20.6.2017 festgehalten, dass die Verbindung einer Person zur Gülen-Bewegung im Falle der Nutzung von Bylock mit Beweisen in Form von technischen Daten unterlegt werden müsse. Das Verfassungsgericht geht von einer ByLock-Nutzung aus, wenn ein Abgleich von User-ID und Einträgen des Telekommunikationsanbieters positiv ausfällt (BAMF 4.11.2024b, S. 6). Im Jahr 2021 legte schließlich auch das Kassationsgericht Leitlinien für die Anwendung des By Lock-Kriteriums fest. Dieses Kriterium kann nur dann gegen Verdächtige verwendet werden, wenn schlüssige Beweise dafür vorliegen, dass sie selbst die Anwendung verwendet haben und nicht jemand anderes. Trotzdem haben sich fallweise Gerichte unterer Instanzen nicht an diese Leitlinie gehalten. Infolgedessen wurden die Urteile gegen zahlreiche Personen, die der Zugehörigkeit zur Gülen-Bewegung für schuldig befunden wurden, später entweder vom Kas sationsgericht oder vom Verfassungsgericht aufgehoben (MBZ 31.8.2023, S. 23; vgl. BAMF 4.11.2024b, S. 7). Die Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen zur willkürlichen Inhaf tierung gab im Oktober 2019 eine Stellungnahme ab, wonach die Nutzung von ByLock unter das Recht auf freie Meinungsäußerung fällt. Solange die türkischen Behörden nicht offen er klären würden, wie die Verwendung von ByLock einer kriminellen Aktivität gleichkommt, wären Verhaftungen aufgrund der Benutzung von ByLock willkürlich (TM 15.10.2019; vgl. UNHRC 18.9.2019). Am 20.7.2021 entschied der EGMR, dass sich der betroffene ehemalige Polizist, Tekin Akgün, zu Unrecht seit 2016 wegen Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung in Untersuchungshaft befin det, und zwar, weil die Festnahme lediglich auf der Benutzung von ByLock fußt. Laut Urteil des EGMR verfügte das türkische Gericht nicht über ausreichende Informationen zu ByLock, um zu dem Schluss zu kommen, dass diese Messenger-Anwendung ausschließlich von Mitgliedern der Gülen-Bewegung zu Zwecken der internen Kommunikation verwendet wurde. In Erman gelung anderer Beweise oder Informationen könne das fragliche Dokument, in dem lediglich festgestellt werde, dass der Kläger ein Nutzer von ByLock sei, für sich genommen nicht darauf hindeuten, dass ein begründeter Verdacht bestehe, dass er ByLock tatsächlich in einer Weise nutzte, die den vorgeworfenen Straftaten gleichkommen könne. Der EGMR stellte dahingehend eine Verletzung von Artikel 5 § 1 (Recht auf Freiheit und Sicherheit), von Artikel 5 § 3 (Recht auf ein Gerichtsverfahren innerhalb einer angemessenen Frist oder auf Freilassung bis zur Ge richtsverfahren) und eine Verletzung von Artikel 5 § 4 (Recht auf eine zügige Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Inhaftierung) der Europäischen Menschenrechtskonvention fest (ECHR 20.7.2021, S. 1). Die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) entschied im September 2023 neuerlich in einem Fall (Yüksel Yalçınkaya vs. Türkei), dass die Verurteilung eines Lehrers wegen seiner Verbindungen zur Gülen-Bewegung und somit als Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt durch ein türkisches Gericht aufgrund von Aktivitäten wie der Nutzung von ByLock oder eines Kontos bei der Asya-Bank rechtswidrig war. Das EGMR kritisierte die Verwendung 40
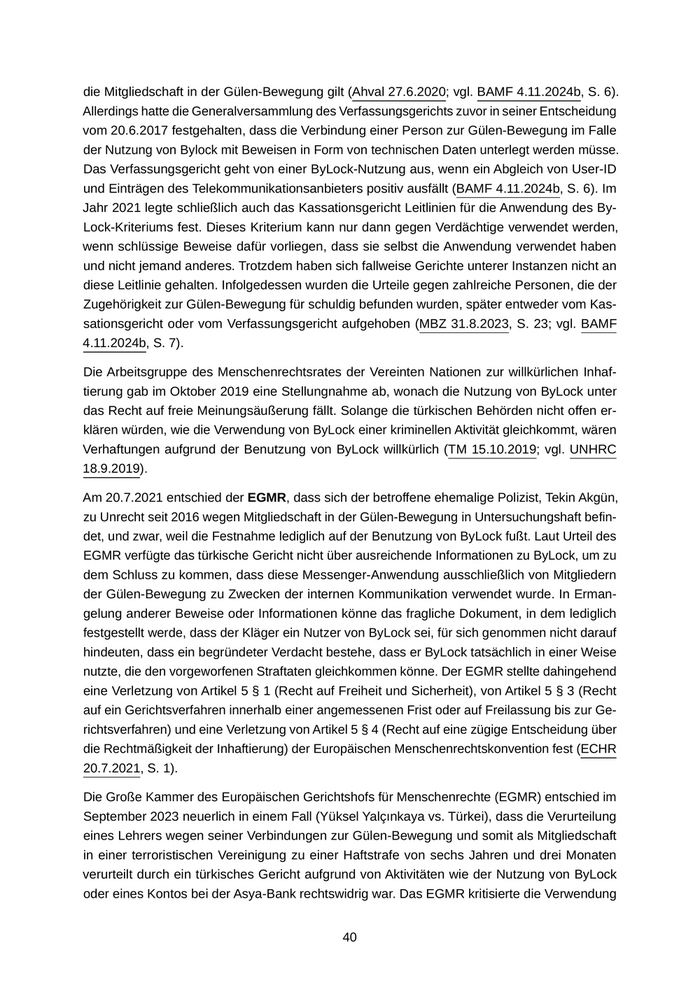
der verschlüsselten Messaging-App „ ByLock“ als Beweismittel durch die Türkei als weitreichend und willkürlich und ohne die notwendigen Garantien für ein faires Verfahren. Darüber hinaus wies das Gericht auf erhebliche Verfahrensmängel im Prozess hin, darunter die Tatsache, dass ihm kein Zugang zu Beweismitteln gewährt und keine unabhängige Prüfung von Daten gestattet wurde (TM 26.9.2023; vgl. SCF 23.7.2024, BAMF 29.7.2024, S. 10). Nichtsdestotrotz werden vermeintliche Gülen-Anhänger weiterhin wegen einstiger Verwendung von Bylock oder des Besitzes eines Kontos bei der Asya Bank verhaftet, so im Juli 2024 (BAMF 29.7.2024, S. 10). Im Falle des Beispiels von Yüksel Yalçınkaya setzte sich bei der Neuverhandlung des Verfahrens im September 2024 das 2. Landgericht in Kayseri über den EGMR hinweg und verurteilte Yalçınkaya erneut aufgrund derselben Anklage (TALI 15.9.2024; vgl. HRW 16.1.2025). Asya Bank Die von Gülen-Anhängern betriebene und getragene „ Bank Asya“ kam nach dem gescheiterten Putschversuch zunehmend unter Druck und wurde ab 22.7.2016 gänzlich unter Verwaltung des Staates gestellt. In vielen Fällen reichte es, über ein Konto bei der Asya Bank zu verfügen, um wegen Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung angeklagt zu werden. Viele Angeklagte wur den jedoch nicht verurteilt, wenn keine weiteren Indizien vorlagen. Allerdings konnte die bloße Einzahlung von Geld bei der Asya-Bank nach dem 25.12.2013 zu einer Suspendierung von Be amten aus dem öffentlichen Dienst führen (ÖB Ankara 28.12.2023, S. 29). Das Kassationsgericht entschied 2018, dass diejenigen, die nach dem Aufruf von Fethullah Gülen Anfang 2014 Geld bei der Bank Asya eingezahlt hatten, als Unterstützer und Begünstiger der Gülen-Bewegung angesehen werden sollten (DS 11.2.2018). Gülen-Schulen Die Gülen-Bewegung betrieb einst Schulen rund um den Globus (BBC 21.7.2016). Die Schlie ßung der Schulen stellt(e) die Gülen-Bewegung vor große Herausforderungen, da sie eine wich tige Rolle bei der Finanzierung und der Anwerbung neuer Anhänger spielten. Um den Zugang des türkischen Staates zu verhindern, erklärten sich viele Schulen nicht mehr als türkische, son dern als lokale Institutionen. Durch eine Mischung aus politischem Druck und wirtschaftlichen Anreizen hat die Türkei versucht, die Gastländer davon zu überzeugen, die Gülen-Schulen, Schülerwohnheime und Universitäten an die Maarif-Stiftung zu übergeben (NZZ 14.2.2020), oder auf der Basis von bilateralen Abkommen mit den jeweiligen Ländern zu schließen bzw. anderen Eigentümern zu übertragen (SCF 5.2.2019; vgl. DS 31.7.2018). Wann immer die Inter ventionen der türkischen Regierung, die Gülen-Schulen zu schließen, sich nicht als erfolgreich erweisen, strebt sie über die Maarif-Stiftung die Eröffnung eigener Schulen an (NZZ 14.2.2020). 2024 betrieb gemäß Eigenangaben die Maarif-Stiftung 460 Bildungseinrichtungen mit 50.000 Schülern in 52 Ländern (Maarif 2024; vgl. DS 5.1.2024). Verfolgung im Ausland: Auslieferungsanträge und Entführungen Im Ausland lebende türkische Staatsangehörige, die mutmaßlich Verbindungen zur Gülen-Be wegung haben, können überwacht und observiert werden, insbesondere wenn sie bekannt sind und nachweislich die Gülen-Bewegung unterstützen. Die Überwachung kann online oder 41