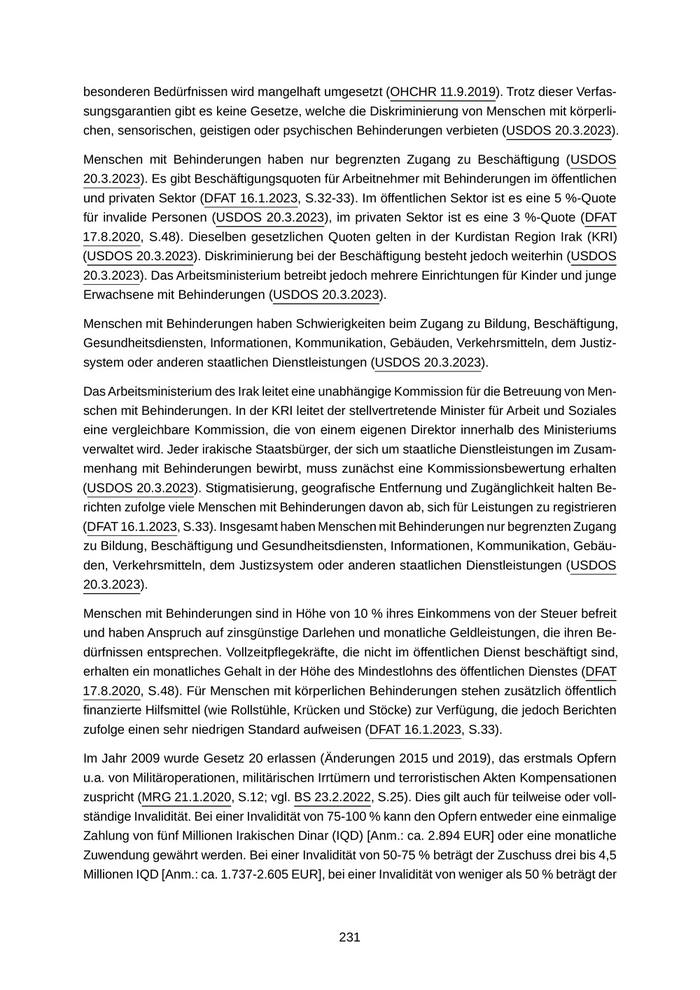2025-09-09-coi-cms-laenderinformationen-irak-version-8-99ad
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Länderinformationsblätter“
Mehrere Quellen berichten, dass die PKK und die Volksschutzeinheiten (YPG), die in der KRI und in Sinjar, Ninewa operieren, weiterhin Kinder rekrutieren und einsetzen. Im Jahr 2021 berichtete eine nicht verifizierte Quelle, dass die PKK Dutzende von Kindern rekrutiert habe, um sie auf den Kampf vorzubereiten, darunter auch Kinder aus Kirkuk (USDOS 1.7.2021). [Anm.: Informationen zu Kinderehen können dem Kapitel Zwangsehen, Kinderehen, temporäre Ehen, Blutgeld-Ehe (Fasliya) entnommen werden, Informationen zu Kindern, die unter dem IS geboren sind finden sich in Kapitel (Mutmaßliche) IS-Mitglieder, IS-Sympathisanten und IS- Familien (Dawa‘esh).] Quellen ■ AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (28.10.2022): Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak (Stand: Oktober 2022), https://www.ecoi.net/e n/file/local/2082728/Auswärtiges_Amt,_Bericht_über_die_asyl-_und_abschiebungsrelevante_ Lage_in_der_Republik_Irak_(Stand_Oktober_2022),_28.10.2022.pdf , Zugriff 23.3.2023 [Login erforderlich] ■ AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (25.10.2021): Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak (Stand: Oktober 2021), https://www.ecoi.net/e n/file/local/2063378/Auswärtiges_Amt,_Bericht_über_die_asyl-_und_abschiebungsrelevante_ Lage_in_der_Republik_Irak_(Stand_Oktober_2021),_25.10.2021.pdf , Zugriff 24.8.2023 [Login erforderlich] ■ DFAT - Department of Foreign Affairs and Trade [Australien] (16.1.2023): DFAT Country Information Report Iraq, https://www.ecoi.net/en/file/local/2085737/country-information-report-iraq.pdf , Zugriff 2.2.2023 ■ FH - Freedom House (2023): Freedom in the World 2023 - Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument /2090187.html, Zugriff 7.7.2023 ■ HRW - Human Rights Watch (12.1.2023): World Report 2023 - Iraq, https://www.ecoi.net/en/docu ment/2085461.html, Zugriff 15.2.2023 ■ HRW - Human Rights Watch (13.1.2022): World Report 2022 - Iraq, https://www.ecoi.net/en/docu ment/2066472.html, Zugriff 13.7.2023 ■ Migrationsverket - Schwedisches Migrationsamt [Schweden] (15.8.2018): Irak - familjerätt och vård nad, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442095/4792_1535708243_180815601.pdf , Zugriff 17.8.2023 ■ STDOK - Staatendokumentation des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl [Österreich] (2023): Iraq: Socio-Economic Survey 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2105194/IRAK_- Socio-Economic Survey 2023.pdf, Zugriff 11.3.2024 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (15.6.2023): 2023 Trafficking in Persons Report: Iraq, https://www.ecoi.net/en/document/2093605.html, Zugriff 11.6.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (20.3.2023): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2089064.html, Zugriff 11.7.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (12.4.2022): 2021 Country Report on Human Rights Practices: Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2071125.html, Zugriff 24.8.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (1.7.2021): 2021 Trafficking in Persons Report: Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2055124.html, Zugriff 25.8.2021 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (30.3.2021): 2020 Country Report on Human Rights Practices: Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2048100.html, Zugriff 11.7.2023 19.2.1 Bildungszugang Letzte Änderung 2024-03-28 08:38 Die Grundschulbildung für Kinder mit irakischer Staatsbürgerschaft ist in den ersten sechs Schul jahren verpflichtend und wird für diese kostenfrei angeboten (USDOS 20.3.2023; vgl. DFAT 222
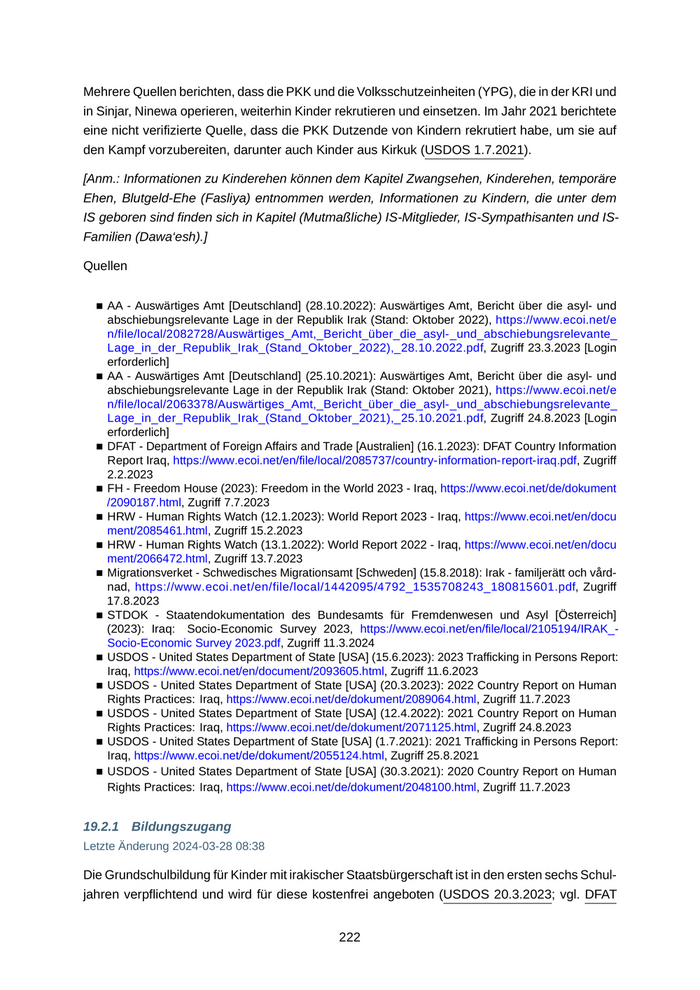
16.1.2023, S. 9, IOM 16.2.2024, S. 5). In der Kurdistan Region Irak (KRI) besteht Schulpflicht bis zum Alter von 15 Jahren. Auch sie ist kostenlos (USDOS 20.3.2023; vgl. DFAT 16.1.2023, S. 9). Seit 2003 gibt es im Irak auch private Schulen, die mit Lizenz des Bildungsministeri ums agieren. Sie sind den öffentlichen Schulen oft überlegen, verlangen aber hohe Gebühren (DFAT 16.1.2023, S. 9; vgl. IOM 16.2.2024, S. 6). Immer mehr Familien aus der oberen Mittel schicht greifen auf Privatschulen zurück, deren Bildungsqualität als höher angesehen wird (IOM 16.2.2024, S. 6). Das formale Bildungssystem im Irak ist in den letzten Jahren erheblich gestört worden (NRC 11.4.2022, S. 7). Das irakische Bildungssystem ist seit den 1990er-Jahren mit Herausforderun gen konfrontiert. Dazu gehören Probleme wie baufällige Gebäude ohne Heiz- und Kühlsysteme sowie unzureichende Sitzplätze für Schüler in einigen Schulen. Die staatlichen Schulen leiden unter Überbelegung, in einigen Fällen unter unzureichendem Lehrpersonal und einer von Gebiet zu Gebiet unterschiedlichen Qualität des Lehrpersonals. Auch politische Instabilität, bewaffnete Konflikte und wirtschaftliche Schwierigkeiten stellen Probleme dar (IOM 16.2.2024, S. 5). Die Sicherheitslage, das Einquartieren von Binnenvertriebenen in Schulgebäuden und eine große Zahl zerstörter Schulen verhinderten und verhindern mancherorts den Schulbesuch, besonders in ländlichen Gebieten (AA 28.10.2022, S. 11). Aufgrund der COVID-19-Pandemie blieben Schulen in den von Bagdad kontrollierten Gebieten im Jahr 2020 für mehrere Monate (von März bis November 2020) geschlossen (HRW 13.1.2021; vgl. AA 28.10.2022, S. 11, USDOS 12.4.2022), in der KRI von März 2020 bis zum Ende des Schuljahres (HRW 13.1.2021). Etwa elf Millionen Kinder waren von diesen Schulschließungen betroffen (DFAT 16.1.2023, S. 9) und haben mindestens 25 Wochen lang nicht am Unterricht teilgenommen (UNICEF 18.2.2023, S. 6). UNICEF unterstützte das Bildungsministerium bei der Übertragung von Unterricht über das Bildungsfernsehen und digitale Plattformen. Der Zu gang der Kinder zu alternativen Lernplattformen über das Internet und das Fernsehen wurde jedoch durch die begrenzte Konnektivität und Verfügbarkeit digitaler Geräte sowie durch den Mangel an Strom behindert. Außerdem hat das Bildungsministerium keine Richtlinien für die Durchführung von Fernunterricht herausgegeben (USDOS 12.4.2022). Schulen wurden vom irakischen Bildungsministerium angewiesen, den Lehrbetrieb aus der Ferne fortzusetzen, ein schließlich der Ablegung von Prüfungen. In den Abschlussjahrgängen müssen die Schüler ihre Prüfungen jedoch in Anwesenheit ablegen. Einige Schulen haben hybride Unterrichtsmodelle eingerichtet, bei denen die Schüler an 2-3 Tagen pro Woche den Unterricht in Anwesenheit besuchen konnten. Ab Mai 2021 wurden jedoch alle Schulen wieder auf Fernstudien umgestellt (IOM 18.6.2021, S. 14). Technische Beschränkungen hinderten die meisten Kinder jedoch dar an, von zu Hause aus zu lernen DFAT 16.1.2023, S. 9). Familien, die durch den Konflikt mit dem Islamischen Staat (IS) vertrieben wurden, sind am meisten durch die Schulschließungen betroffen, da die meisten von ihnen keinen Zugang zu digitalen Lernmöglichkeiten haben (HRW 13.1.2021). Ebenso stellen Fernstudien Familien mit geringem Einkommen oder aus entlege nen Gebieten vor ein Hindernis, da diese eine stabile Internetleitung und adäquates Equipment erfordern (IOM 18.6.2021, S. 14). Ende 2019 waren schätzungsweise 345.000 Kinder im Irak 223
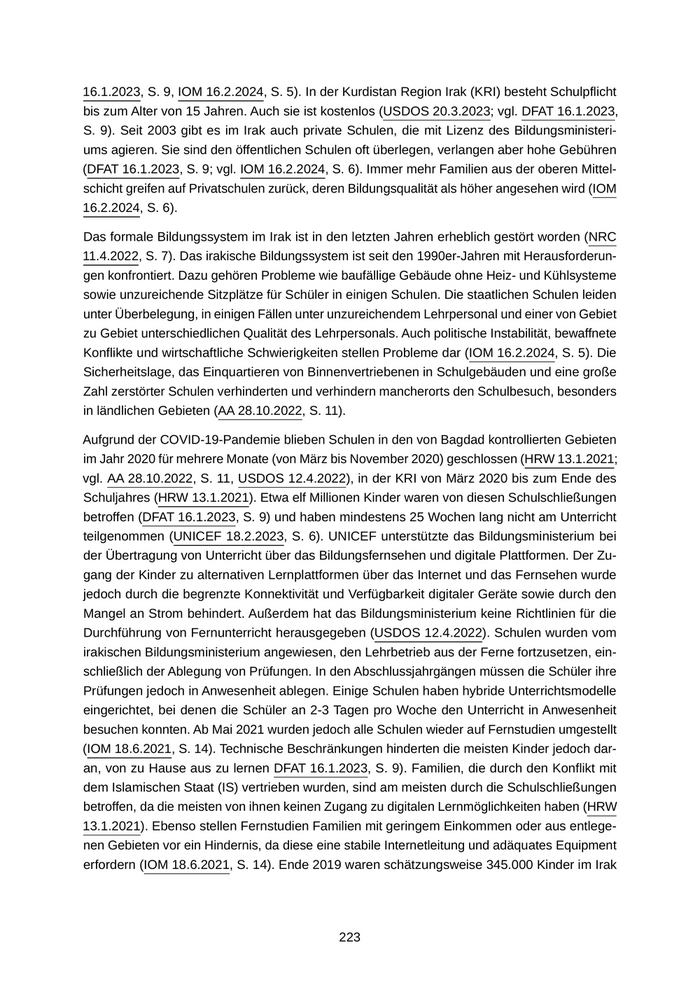
ohne Schulabschluss. Nach der COVID-19-Pandemie ist davon auszugehen, dass diese Zahl gestiegen ist (NRC 11.4.2022, S. 7). Nach Angaben des Planungsministeriums von Februar 2022 liegt die Alphabetisierungsrate von Frauen bei 83 % im Vergleich zu 92 % bei den Männern (AA 28.10.2022, S. 12). Laut UNESCO waren 2017 79,9 % der Frauen und 91,2 % der Männer über 15 Jahre des Lesens und Schreibens mächtig (BS 23.2.2022, S. 26). Zum Unterschied dazu sind in der KRI fast alle Menschen des Lesens und Schreibens mächtig (AA 28.10.2022, S. 11). Ein gleichberechtigter Zugang von Mädchen zu Bildung bleibt eine Herausforderung, insbeson dere in ländlichen und unsicheren Gebieten (USDOS 12.4.2022). Mehrere Bevölkerungsgruppen sind gefährdet, nicht in die Schule zu gehen, darunter Mädchen, Kinder mit Behinderungen, von Vertreibung betroffene Kinder, Kinder ohne Papiere und junge Menschen, die in Armut leben (NRC 11.4.2022, S. 7). Tausende von Kindern ohne Ausweispapiere werden von den Behörden weiterhin daran gehindert, staatliche Schulen zu besuchen, darunter auch staatliche Schulen in Vertriebenenlagern (HRW 13.1.2022). Kinder, die keine Schule besuchen, sind anfälliger für Ausbeutung und Missbrauch, einschließlich Kinderarbeit, Rekrutierung durch bewaffnete Akteure und Frühverheiratung (IOM 16.2.2024, S. 5). Fast die Hälfte aller vertriebenen Kinder im schulpflichtigen Alter - etwa 355.000 Kinder - gehen nicht zur Schule. Schätzungsweise 680.000 Binnenvertriebenen- und Rückkehrerkindern wird der Zugang zur Bildung erschwert. Besonders besorgniserregend ist die Situation in den vom Konflikt betroffenen Gouvernements wie Salah ad-Din und Diyala, wo mehr als 90 % der Kinder im schulpflichtigen Alter vom Bildungssystem ausgeschlossen sind (IOM 16.2.2024, S. 5). Die Einschulungsquoten von Mädchen sind auf allen Bildungsebenen gestiegen, liegen aber immer noch unter denen der Buben (BS 23.2.2022, S. 27; vgl. DFAT 16.1.2023, S. 9). Mädchen brechen die Ausbildung tendenziell häufiger ab als Buben (BS 23.2.2022, S. 27). So waren im Jahr 2018 28 % der Mädchen und 15 % der Buben im Alter der unteren Sekundarstufe nicht in der Schule (UNICEF 18.2.2023, S. 6). Besonders in den vormals vom IS kontrollierten Gebieten gehen Mädchen seltener zur Schule (DFAT 16.1.2023, S. 9). Eine 2018 durchgeführte Umfrage zur Situation von Kindern im Irak hat ergeben, dass 91,6 % der Kinder im Irak in der Grundschule eingeschrieben sind (92,7 % der Buben, 90,4 % der Mädchen) (UNICEF/CSO 2.2019, S. 214- 218; vgl. NRC 11.4.2022, S. 7). Im föderalen Irak sind dies 90,8 % (92,2 % der Buben, 89,3 % der Mädchen), in der KRI sind es 96 % (95,8 % der Buben, 96,2 % der Mädchen). Der Anteil der Kinder aus urbanen Gebieten, die eine Grundschule besuchen, ist dabei mit 93 % höher als jener in ruralen Gebieten mit 88,6 %. Entsprechend sinkt auch der Anteil der Buben von 93,8 % auf 90,5 % und der der Mädchen von 92,2 % auf 86,7 %. Der Anteil der Kinder, die die untere Sekundarstufe (Unterstufe) besuchen, liegt bei 57,5 %, wobei der Anteil von Buben und Mädchen gleich ist. Im föderalen Irak sind dies 55,6 % (56,5 % der Buben, 54,7 % der Mädchen), in der KRI sind es 67,1 % (63,1 % der Buben, 70,6 % der Mädchen). Auch hier ist der Anteil der Kinder aus urbanen Gebieten mit 64,5 % (63,7 % der Buben, 65,2 % der Mädchen) höher als der in ruralen Gebieten mit 43,8 % (45,2 % der Buben, 42,4 % der Mädchen) (UNICEF/ CSO 2.2019, S. 214-218). 46 % der Kinder schließen die Sekundarstufe I nicht ab (UNICEF 224
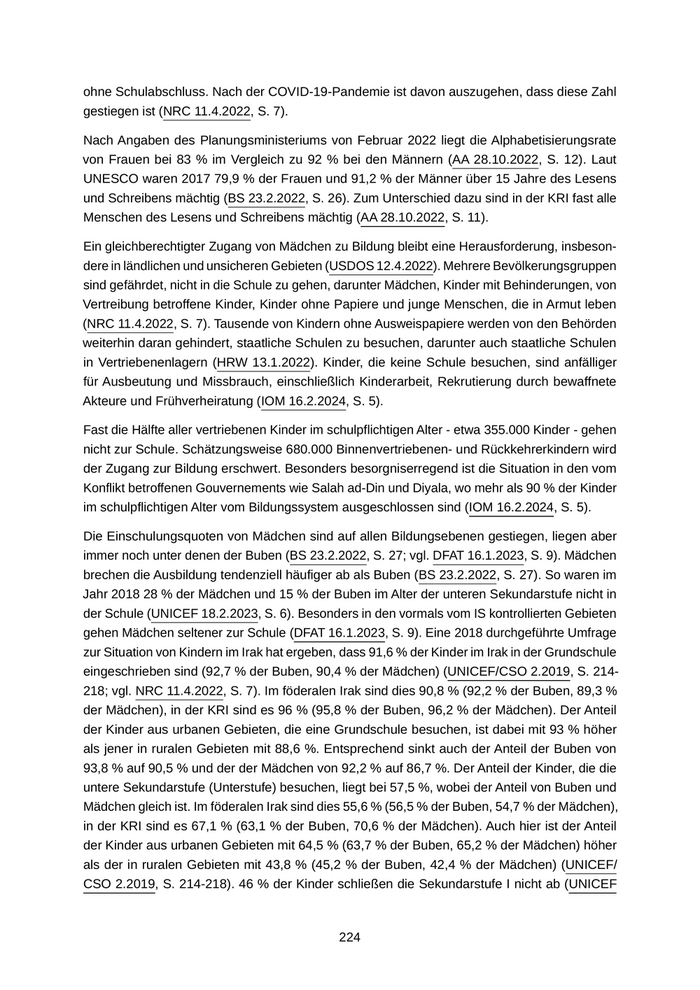
18.2.2023, S. 6). Der Anteil der Kinder, die die obere Sekundarstufe (Oberstufe) besuchen, liegt bei 24,2 % (31 % der Buben, 35,3 % der Mädchen). Im föderalen Irak sind dies 28,8 % (28,0 % der Buben, 29,7 % der Mädchen), in der KRI sind es 52 % (44,4 % der Buben, 60,7 % der Mädchen). Auch hier ist der Anteil der Kinder aus urbanen Gebieten mit 37 % (34,4 % der Buben, 39,6 % der Mädchen) höher als der in ruralen Gebieten mit 24,9 % (24,1 % der Buben, 25,7 % der Mädchen) (UNICEF/CSO 2.2019, S. 214-218). Aktuelle, verlässliche Statistiken über Einschreibungen, Anwesenheit oder Abschlüsse sind nicht verfügbar (USDOS 30.3.2021). Einer Umfrage von 2021 zufolge, die in Bagdad, Basra und Mossul im Auftrag der Staatendoku mentation durchgeführt wurde, geben 65 % der Befragten an, dass ihre Kinder zur Schule gehen können, während die Kinder von 24 % nicht zur Schule gehen. Während 72 % der von Männern geführten Haushalte angeben, dass ihre Kinder zur Schule gehen können, sind es bei den von Frauen geführten Haushalten nur 56 %. Auch regional gibt es erhebliche Unterschiede in Bezug auf den Schulbesuch: In Mossul liegt die Quote bei 82 %, in Basra bei 74 % und in Bagdad bei 56 %. Was die ethnischen Gruppen betrifft, so gehen die Kinder von 67 % der Araber und 61 % der Kurden zur Schule. 57 % der Christen geben an, dass sie ihre Kinder zur Schule schicken können, ebenso wie 74 % der schiitischen und 68 % der sunnitischen Muslime. 92 % der Kinder derjenigen, die mehr als 700.000 IQD [Anm.: 100.000 IQD entsprechen rund 71 EUR, Stand August 2023] verdienen, gehen zur Schule, aber nur 63 % derjenigen, die weniger verdienen (STDOK/IRFAD 2021, S. 36-38). Einer Umfrage aus dem Jahr 2023 zufolge gaben 62 % aller Befragten mit Kindern im Alter von 15 Jahren oder jünger an (n = 271), dass alle ihre Kinder zur Schule gehen können (Bagdad 60 %, Basra 63 %, Mossul 63 %). 18 % antworteten, dass einige ihrer Kinder die Schule besuchen können (Bagdad 21 %, Basra 13 %, Mossul 21 %), während 19 % zugaben, dass keines ihrer Kinder in die Schule gehen kann (Bagdad 19 %, Basra 22 %, Mossul 16 %). 2% der Befragten in Basra 2 % beantworteten die Frage nicht (STDOK 2023, S. 55-57). 70 % der Befragten geben an, dass ihre Kinder eine öffentliche Schule besuchen, während nur 16 % eine Privatschule besuchen. Regional gesehen besuchen 82 % der Kinder in Mossul, 78 % in Basra und 62 % in Bagdad eine öffentliche Schule, während 18 % in Mossul, 22 % in Basra und 14 % in Bagdad eine Privatschule besuchen. Während die Quote bei den öffentlichen Schulen ähnlich hoch ist, besuchen 19 % der kurdischen Kinder eine Privatschule, gegenüber 9 % der arabischen Kinder. Auch die religiösen Gruppen weisen unterschiedliche Muster auf: Öffentliche Schulen werden von 61 % der Kinder von Christen, 84 % der Kinder von schiitischen Muslimen und 73 % der Kinder von sunnitischen Muslimen besucht. Privatschulen werden von 26 % der Kinder von Christen, 9 % der Kinder von schiitischen Muslimen und 15 % der Kinder von sunnitischen Muslimen besucht. 30 % der Kinder von Personen mit einem Einkommen von mehr als 700.000 IQD besuchen eine Privatschule, aber nur 13 % der Kinder von Personen mit einem geringeren Einkommen. 39 % der Befragten geben an, weniger als 70.000 IQD pro Kind für die Schule zu zahlen, während nur 4 % zwischen 150.000 und 300.000 IQD zahlen. In Bagdad zahlen 34 % weniger als 70.000 IQD, ebenso 39 % in Basra und 54 % in Mosul; nur in Bagdad zahlen einige der Befragten (7 %) zwischen 150.000 und 300.000 IQD. 56 % der Kurden zahlen weniger als 70.000 IQD pro Kind und Monat, gegenüber 35 % der Araber. 225
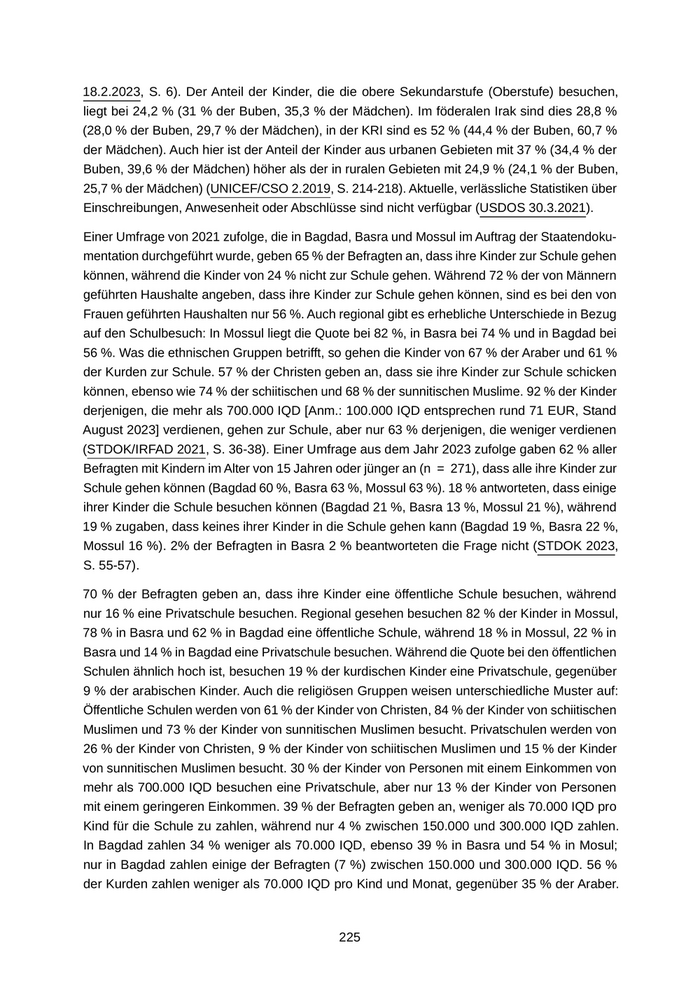
Was die religiösen Gruppen betrifft, so geben 54 % der sunnitischen Muslime an, weniger als 70.000 pro Monat zu zahlen, ebenso wie 30 % der Christen und 32 % der schiitischen Muslime (STDOK/IRFAD 2021, S. 38-42). 60 % der Befragten geben an, dass ihre Kinder keinen Zugang zu höherer und weiterführender Bildung haben, während dieser für 31 % der Befragten gegeben ist. Von den weiblich geführten Haushalten haben nur 25 % der Befragten Hochschulzugang, während es 37 % bei männlich geführten Haushalten sind. Regionale Unterschiede zeigen, dass in Basra 83 % keinen Zugang haben, ebenso wie 77 % in Mossul, aber nur 42 % in Bagdad. 65 % der Kurden geben an, dass sie keinen Zugang zur Hochschulbildung haben, während 58 % der Araber keinen Zugang haben. Der fehlende Zugang ist fast gleichmäßig auf die Konfessionen verteilt: 60 % der Christen, 64 % der schiitischen Muslime und 64 % der sunnitischen Muslime. Weiters hat die Befragung ergeben, dass 58 % derjenigen, die mehr als 700.000 IQD verdienen und 34 % derjenigen, die weniger als 700.000 IQD verdienen, einen Zugang zu höherer Bildung haben (STDOK/IRFAD 2021, S. 45-46). Quellen ■ AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (28.10.2022): Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak (Stand: Oktober 2022), https://www.ecoi.net/e n/file/local/2082728/Auswärtiges_Amt,_Bericht_über_die_asyl-_und_abschiebungsrelevante_ Lage_in_der_Republik_Irak_(Stand_Oktober_2022),_28.10.2022.pdf , Zugriff 23.3.2023 [Login erforderlich] ■ BS - Bertelsmann Stiftung (23.2.2022): BTI 2022 Country Report Iraq, https://www.ecoi.net/en/file/l ocal/2069660/country_report_2022_IRQ.pdf, Zugriff 11.7.2023 ■ DFAT - Department of Foreign Affairs and Trade [Australien] (16.1.2023): DFAT Country Information Report Iraq, https://www.ecoi.net/en/file/local/2085737/country-information-report-iraq.pdf , Zugriff 2.2.2023 ■ HRW - Human Rights Watch (13.1.2022): World Report 2022 - Iraq, https://www.ecoi.net/en/docu ment/2066472.html, Zugriff 13.7.2023 ■ HRW - Human Rights Watch (13.1.2021): World Report 2021 - Iraq, https://www.ecoi.net/de/doku ment/2043505.html, Zugriff 16.8.2023 ■ IOM - International Organization for Migration (16.2.2024): Information on the state of basic health care and access to education in Baghdad/Iraq, Auskunft per E-Mail ■ IOM - International Organization for Migration (18.6.2021): Information on the socio-economic situ ation in the light of COVID-19 in Iraq and in the Kurdish Region, requested by the Austrian Federal Office for Immigration and Asylum ■ NRC - Norwegian Refugee Council (11.4.2022): Gaps in Formal Education in Iraq, https://www.nrc. no/globalassets/pdf/reports/gaps-in-formal-education-in-iraq/gaps-in-formal-education-in-iraq---eci .pdf, Zugriff 18.8.2023 ■ STDOK - Staatendokumentation des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl [Österreich] (2023): Iraq: Socio-Economic Survey 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2105194/IRAK_- Socio-Economic Survey 2023.pdf, Zugriff 11.3.2024 ■ STDOK/IRFAD - Staatendokumentation des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl [Österreich] (Herausgeber), Iraqi Foundation for Analysis and Development (Autor) (2021): Dossier Iraq; Socio- Economic Survey 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2062611/IRAQ - Socio-Economic Survey 2021.pdf, Zugriff 16.8.2023 ■ UNICEF - United Nations International Children’s Emergency Fund (18.2.2023): UNICEF in Iraq An nual Report 2022, https://www.unicef.org/iraq/media/2411/file/Annual Report 2022 - Eng..pdf, Zugriff 18.8.2023 ■ UNICEF/CSO - United Nations International Children’s Emergency Fund, Central Statistical Or ganization Iraq, Ministry of Planning [Irak] (2.2019): 2018 Multiple Indicator Cluster Survey, Survey 226
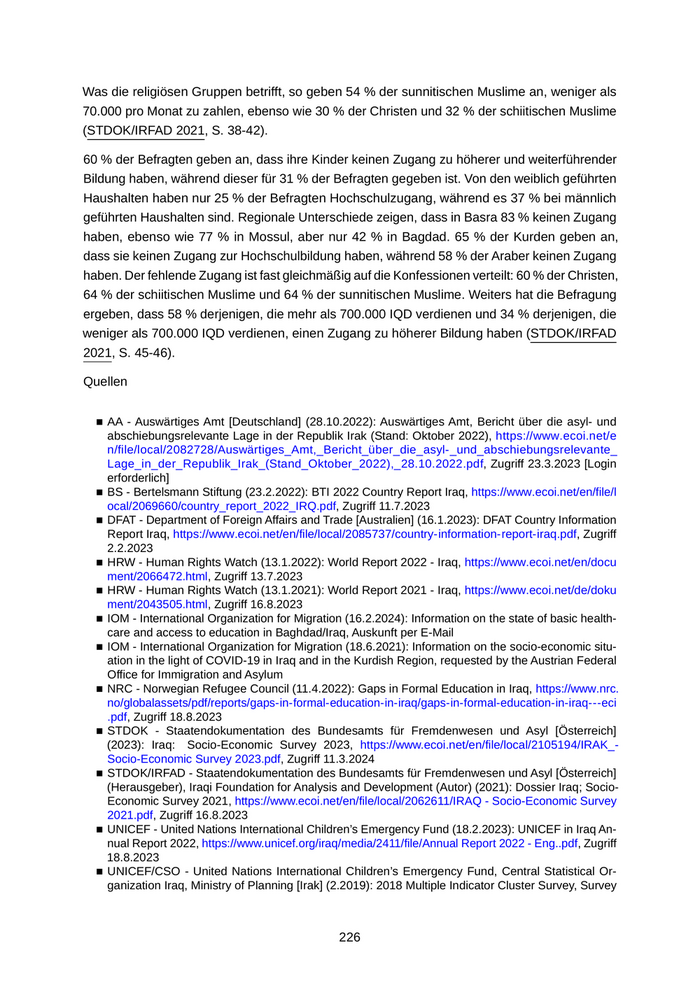
Findings Report, https://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTkvMDMvMDEvMTkvMjMvMTgvNT g5L0VuZ2xpc2gucGRmIl1d&sha=aea1de7cc6f6ec09, Zugriff 16.8.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (20.3.2023): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2089064.html, Zugriff 11.7.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (12.4.2022): 2021 Country Report on Human Rights Practices: Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2071125.html, Zugriff 24.8.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (30.3.2021): 2020 Country Report on Human Rights Practices: Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2048100.html, Zugriff 11.7.2023 19.3 Sexuelle Minderheiten Letzte Änderung 2024-03-28 11:02 Das Strafgesetzbuch des Irak verbietet gleichgeschlechtliche Intimität nicht (HRW 13.1.2022; vgl. AA 28.10.2022, S.13, FH 2023, DFAT 16.1.2023, S.31). Das Strafgesetzbuch stellt jedoch einvernehmliche gleichgeschlechtliche Handlungen unter Strafe, wenn die Beteiligten jünger als 18 Jahre sind (USDOS 20.3.2023). Nach Artikel 394 ist jedoch das Eingehen einer au ßerehelichen sexuellen Beziehung strafbar (HRW 13.1.2022; vgl. AA 28.10.2022, S.13, DFAT 16.1.2023, S.31). In welchem Ausmaß andere Gesetze, wie z.B. die Artikel 400 bis 402, die sich mit unsittlichen Handlungen auseinandersetzen, gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen angewendet werden können, ist nicht bekannt (AA 28.10.2022, S.13-14). Artikel 401 bestraft unsittliches Verhalten in der Öffentlichkeit mit bis zu sechs Monaten Haft (HRW 13.1.2022; vgl. USDOS 20.3.2023). Es handelt sich um eine vage Bestimmung, die zur Verfolgung sexueller und gleichgeschlechtlicher Minderheiten herangezogen werden kann, auch wenn kein derartiger Fall dokumentiert ist (HRW 13.1.2021; vgl. UNHRCOM 16.8.2022, S.3). Erwachsene, die we gen einvernehmlichen außerehelichen Geschlechtsverkehrs, einschließlich Sodomie (nach dem Gesetz definiert als Analverkehr zwischen zwei Männern), mit einem anderen Erwachsenen ver urteilt werden, können mit bis zu sieben Jahren Haft bestraft werden. Verurteilungen sind jedoch aufgrund hoher Beweisanforderungen - das Ertappen in flagranti - und der gesellschaftlichen Norm, darüber nicht zu sprechen, selten (USDOS 20.3.2023). Angehörige sexueller Minderheiten (lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und/oder inter sexuelle Menschen, LGBTIQ+) genießen aufgrund gesellschaftlicher Diskriminierung nicht die gleichen politischen Rechte und haben keine parteipolitische Vertretung (FH 2023). Homose xualität wird weitgehend tabuisiert und von großen Teilen der Bevölkerung als unvereinbar mit Religion und Kultur abgelehnt (AA 28.10.2022, S.13). Transgenderpersonen ist es weder mög lich, auf legalem Weg geschlechtsangleichende Operationen oder eine Hormonersatztherapie zu erhalten, noch rechtliche Dokumente, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen (USDOS 20.3.2023). Homosexuelle leben ihre Sexualität meist gar nicht oder nur heimlich aus und sehen sich Dis kriminierung und sozialer Ausgrenzung und Ächtung ausgesetzt (AA 28.10.2022, S.13; vgl. FH 2023, DFAT 16.1.2023, S.31). LGBTIQ+-Personen sind mitunter auch mit der Verweigerung von Arbeitsplätzen und Dienstleistungen, einschließlich der Gesundheitsversorgung, sowie mit Mobbing oder dem Ausschluss vom Bildungswesen konfrontiert (DFAT 16.1.2023, S.32). 227
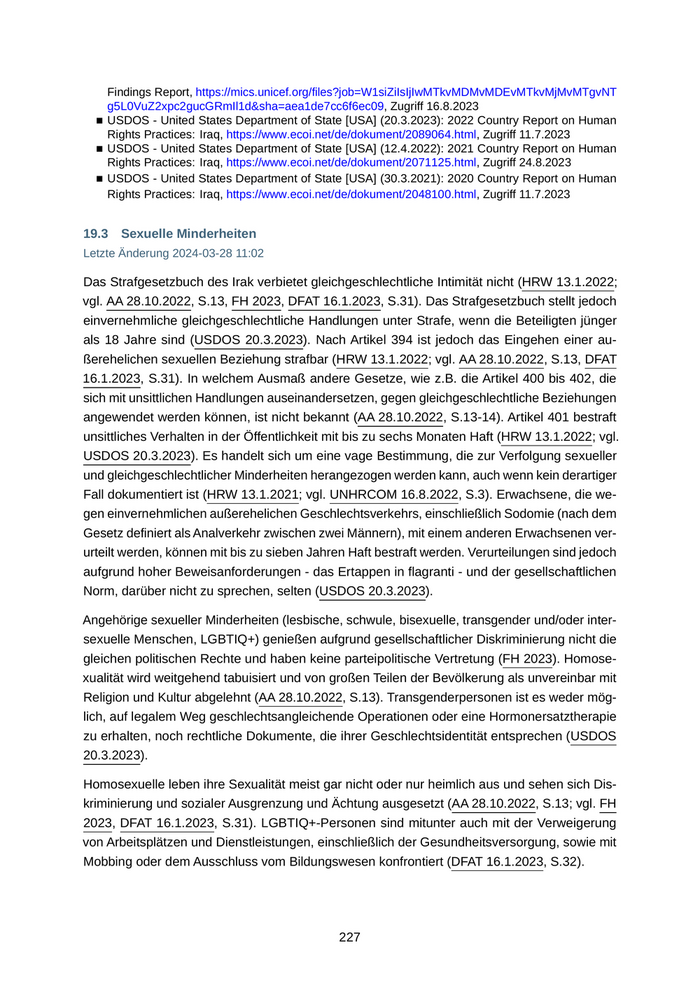
Es besteht für LGBTIQ+-Personen ein hohes Risiko, Ziel von Gewalt zu werden (AA 28.10.2022, S.13; vgl. FH 2023, DFAT 16.1.2023, S.31), bis hin zu Ehrenmorden (AA 28.10.2022, S.13; vgl. DFAT 16.1.2023, S.31). Gefahr für LGBTIQ+-Personen geht einerseits von ihren Familien und ihren Gemeinschaften aus (DFAT 16.1.2023, S.31), andererseits werden auch Sicherheitskräfte, einschließlich staatlich geförderte Milizen, sowie nicht-staatliche bewaffnete Gruppen beschuldigt, gewaltsam gegen LGBTIQ+-Personen vorzugehen (DFAT 16.1.2023, S.31; vgl. HRW 12.1.2023). Milizen haben in den letzten Jahren wiederholt Mitglieder sexueller Minderheiten bedroht und verfolgt und werden mit Ermordungen von homosexuellen Männern in Verbindung gebracht (AA 28.10.2022, S.13; vgl. HRW 13.1.2022, BS 23.2.2022, S.14). Die Gruppen, die in die schwersten Übergriffe verwickelt sind, sind Asa’ib Ahl al-Haqq, Atabat Mobilization, Badr Organization, Kata’ib Hiz bollah, Raba Allah Group und Saraya as-Salam (HRW 23.3.2022). Auch staatliche Behörden werden damit in Verbindung gebracht (BS 23.2.2022, S.14). Angehörige sexueller Minderheiten werden von Angehörigen bewaffneter Gruppen entführt, vergewaltigt, gefoltert und getötet, von Polizeibeamten verhaftet und ebenfalls der Gewalt ausgesetzt (HRW 23.3.2022). Nach Angaben von NGOs haben Iraker, die aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität schwere Diskriminierung, Folter, Körperverlet zung oder Todesdrohungen erleiden, keine Möglichkeit, gegen diese Handlungen vor Gerichten oder staatlichen Institutionen vorzugehen (USDOS 20.3.2023). Staatlicher Schutz vor Über griffen ist unzureichend oder nicht vorhanden (DFAT 16.1.2023, S.31; vgl.USDOS 20.3.2023, HRW 13.1.2022). Ein 2012 gegründetes Regierungskomitee, das sich mit dem Missbrauch von sexuellen Minderheiten befasst, unternahm nur wenige konkrete Schritte, um diese zu schützen, bevor es sich auflöste (HRW 13.1.2021). Die Polizei wird mitunter eher als Bedrohung, denn als Schutz empfunden (AA 28.10.2022, S.13). Für Täter aus den Reihen der Sicherheitskräfte, inklusive Milizen, herrscht weitgehend Straflosigkeit (HRW 12.1.2023).Staatliche Rückzugsorte für Angehörige sexueller Minderheiten gibt es nicht, die Anzahl privater Schutzinitiativen ist sehr beschränkt (AA 28.10.2022, S.13). In Folge öffentlicher Entrüstung nach dem Hissen der Regenbogenflaggen auf dem gemein samen Gelände der britischen, kanadischen und EU-Botschaft im Mai 2020 wurden um die elf Angehörige sexueller Minderheiten mutmaßlich wegen ihrer sexuellen Orientierung getötet (AA 28.10.2022, S.13). Im Jahr 2021 wurden Angehörige sexueller Minderheiten, sowie Personen, die als solche wahrgenommen wurden, an Checkpoints körperlich, verbal und sexuell belästigt. Angehörige sexueller Minderheiten wurden willkürlich verhaftet und in Polizeigewahrsam Miss handlungen wie Folter, erzwungenen Analuntersuchungen, schweren Schlägen und sexueller Gewalt ausgesetzt (HRW 13.1.2022). HRW dokumentierte auch Fälle digitaler Überwachung durch bewaffnete Gruppen in sozialen Medien und bei gleichgeschlechtlichen Dating-Seiten (HRW 13.1.2022; vgl. DFAT 16.1.2023, S.32). Im Februar 2022 wurde eine Transfrau von ihrem Bruder in Duhok ermordet (DFAT 16.1.2023, S.31). 228
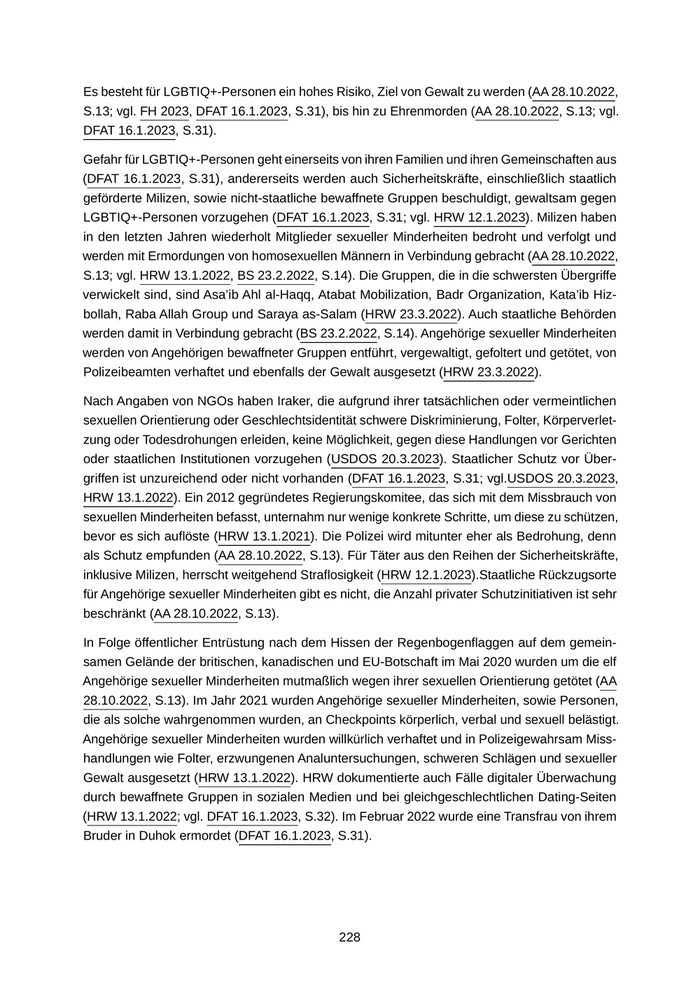
Ende 2022 rief Muqtada as-Sadr zum Kampf gegen die LGBTIQ+-Gemeinschaft auf, wobei er klarstellte, dass dieser Kampf nicht mit Gewalt, Mord oder Drohungen geführt werden solle, son dern mit Bildung, Bewusstsein, Logik und hohen moralischen Standards (USDOS 20.3.2023). Kurz darauf wurde ein Gesetzesentwurf zum Verbot von „ LGBTIQ+-Propaganda“ eingebracht, unterstützt von 25 Abgeordneten, dessen Vorlage zur Abstimmung jedoch von Parlaments sprecher al-Halbusi abgelehnt wurde, mit der Begründung, dass die bestehenden Gesetze homosexuelles Verhalten ausreichend kriminalisieren würden (USDOS 20.3.2023). Auch in der Kurdistan Region Irak (KRI) sind Angehörige sexueller Minderheiten Einschüchterun gen und Drohungen, Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt (USDOS 30.3.2021). Verhaftungen von Mitgliedern der LGBTIQ+-Gemeinschaft sind laut der Direktorin von Rasan in der KRI immer noch an der Tagesordnung (IPS 25.11.2022). Im April 2021 haben kurdische Sicherheitskräfte in Sulaymaniyah mehrere schwule Männer verhaftet. Der Operationsleiter gab zuvor an, dass sich die Razzia gegen„ Unmoral“ richte (VOA 9.4.2021; vgl. USDOS 12.4.2022, IPS 25.11.2022). Den Behörden zufolge handelt es sich hierbei um eine Operation im Kampf gegen Prostitution (VOA 9.4.2021; vgl. USDOS 12.4.2022). Schikanen erstrecken sich auch auf Unterstützer der Gemeinschaft (IPS 25.11.2022). Im September 2022 wurde dem kurdischen Parlament ein Gesetzesentwurf zum „ Verbot der Förderung von Homosexualität“ vorgelegt. Laut diesem Gesetzesentwurf würden Personen oder Gruppen, die sich für LGBTIQ+-Rechte einsetzen oder „ für Homosexualität werben“, mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bestraft werden können (HRW 12.1.2023; vgl. DFAT 16.1.2023, S.31). Das Strafmaß kannbis zu einem Jahr Haft und eine Geldstrafe von bis zu 5 Million IQD [rund 3.540 EUR, Stand August 2023] ausmachen (DFAT 16.1.2023, S.31). Im Jahr 2022 stellte die kurdische NGO Rasan ihre Tätigkeiten wegen fehlender Registrierung ein, nachdem sie mit drei Klagen konfrontiert wurde. Ihr wurde unter anderem vorgeworfen, sich ohne passende Registrierung für LGBTIQ+-Personen eingesetzt zu haben (USDOS 20.3.2023). Anfang August 2023 hat die irakische Medienaufsichtsbehörde, die Kommunikations- und Me dienkommission (CMC), angeordnet, dass alle im Irak tätigen Medien- und Social-Media-Un ternehmen, sowie alle von der CMC lizenzierten Telefon- und Internetunternehmen den Begriff „ Homosexualität“ nicht mehr verwenden dürfen und stattdessen von „ sexueller Abweichung“ sprechen müssen. Auch der Begriff „ Geschlecht“ (gender) ist verboten. Einem Regierungsspre cher zufolge sei die Strafe für einen Verstoß gegen diese Vorschrift noch nicht festgelegt, sie könne aber eine Geldstrafe beinhalten (REU 9.8.2023). Quellen ■ AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (28.10.2022): Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak (Stand: Oktober 2022), https://www.ecoi.net/e n/file/local/2082728/Auswärtiges_Amt,_Bericht_über_die_asyl-_und_abschiebungsrelevante_ Lage_in_der_Republik_Irak_(Stand_Oktober_2022),_28.10.2022.pdf , Zugriff 23.3.2023 [Login erforderlich] ■ BS - Bertelsmann Stiftung (23.2.2022): BTI 2022 Country Report Iraq, https://www.ecoi.net/en/file/l ocal/2069660/country_report_2022_IRQ.pdf, Zugriff 11.7.2023 229
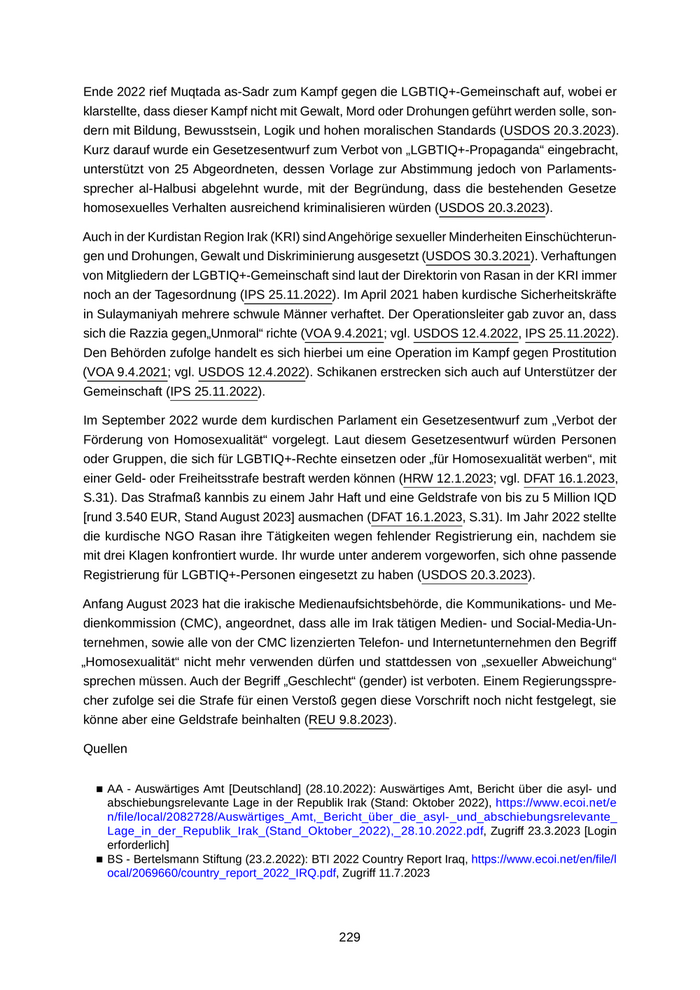
■ DFAT - Department of Foreign Affairs and Trade [Australien] (16.1.2023): DFAT Country Information Report Iraq, https://www.ecoi.net/en/file/local/2085737/country-information-report-iraq.pdf , Zugriff 2.2.2023 ■ FH - Freedom House (2023): Freedom in the World 2023 - Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument /2090187.html, Zugriff 7.7.2023 ■ HRW - Human Rights Watch (12.1.2023): World Report 2023 - Iraq, https://www.ecoi.net/en/docu ment/2085461.html, Zugriff 15.2.2023 ■ HRW - Human Rights Watch (23.3.2022): Iraq: Impunity for Violence Against LGBT People; Killings, Abductions, Torture, Sexual Violence by Armed Forces, https://www.ecoi.net/en/document/2069992 .html, Zugriff 21.4.2023 ■ HRW - Human Rights Watch (13.1.2022): World Report 2022 - Iraq, https://www.ecoi.net/en/docu ment/2066472.html, Zugriff 13.7.2023 ■ HRW - Human Rights Watch (13.1.2021): World Report 2021 - Iraq, https://www.ecoi.net/de/doku ment/2043505.html, Zugriff 16.8.2023 ■ IPS - Inter Press Service (25.11.2022): LGBTI Community in Iraq - Defending Identity in the Face of Harassment, Stigma and Death, https://www.ipsnews.net/2022/11/lgtbi-community-in-iraq-defendi ng-identity-face-harassment-stigma-death/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=l gtbi-community-in-iraq-defending-identity-face-harassment-stigma-death , Zugriff 17.8.2023 ■ REU - Reuters (9.8.2023): Iraq bans media from using term ‘homosexuality’, says they must use ‘sexual deviance’, https://www.reuters.com/world/middle-east/iraq-bans-media-using-term-homos exuality-says-they-must-use-sexual-deviance-2023-08-08/ , Zugriff 18.8.2023 ■ UNHRCOM - United Nations UN Human Rights Committee (16.8.2022): Concluding observations on the sixth periodic report of Iraq [CCPR/C/IRQ/CO/6], https://www.ecoi.net/en/file/local/2077747 /G2246181.pdf, Zugriff 8.2.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (20.3.2023): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2089064.html, Zugriff 11.7.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (12.4.2022): 2021 Country Report on Human Rights Practices: Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2071125.html, Zugriff 24.8.2023 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (30.3.2021): 2020 Country Report on Human Rights Practices: Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2048100.html, Zugriff 11.7.2023 ■ VOA - Voice of America (9.4.2021): LGBTQ Members Face Threats in Iraqi Kurdistan, https://www. voanews.com/extremism-watch/lgbtq-members-face-threats-iraqi-kurdistan , Zugriff 17.8.2023 19.4 Menschen mit Behinderung oder besonderen Bedürfnissen Letzte Änderung 2023-10-09 16:25 Der Irak hat eine der weltweit höchsten Raten an Menschen mit Behinderungen (OHCHR 11.9.2019; vgl. DFAT 16.1.2023, S.32, HRW 13.1.2022). Dieser hohe Anteil an Menschen mit Behinderungen geht zum Teil auf konfliktbedingte Verletzungen, durch Kämpfe, terroristische Angriffe sowie Sprengsätze und Minen zurück. Weitere Faktoren sind Geburtsfehler, die durch mit Uran angereicherte Waffen verursacht wurden, die während der Konflikte von 1990 und 2003 zum Einsatz kamen, sowie chronische Krankheiten. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung leidet an psychischen Beeinträchtigungen (DFAT 16.1.2023, S.32). Der Irak hat das internationale Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinde rungen 2012 ratifiziert (AA 25.10.2021, S.20). Laut Verfassung garantiert die Regierung durch Gesetze und Verordnungen die soziale und gesundheitliche Sicherheit von Menschen mit Be hinderungen, unter anderem durch den Schutz vor Diskriminierung und die Bereitstellung von Wohnraum und speziellen Pflege- und Rehabilitationsprogrammen (USDOS 20.3.2023). Das Gesetz Nr. 38 aus dem Jahr 2013 über die Betreuung von Menschen mit Behinderungen und 230
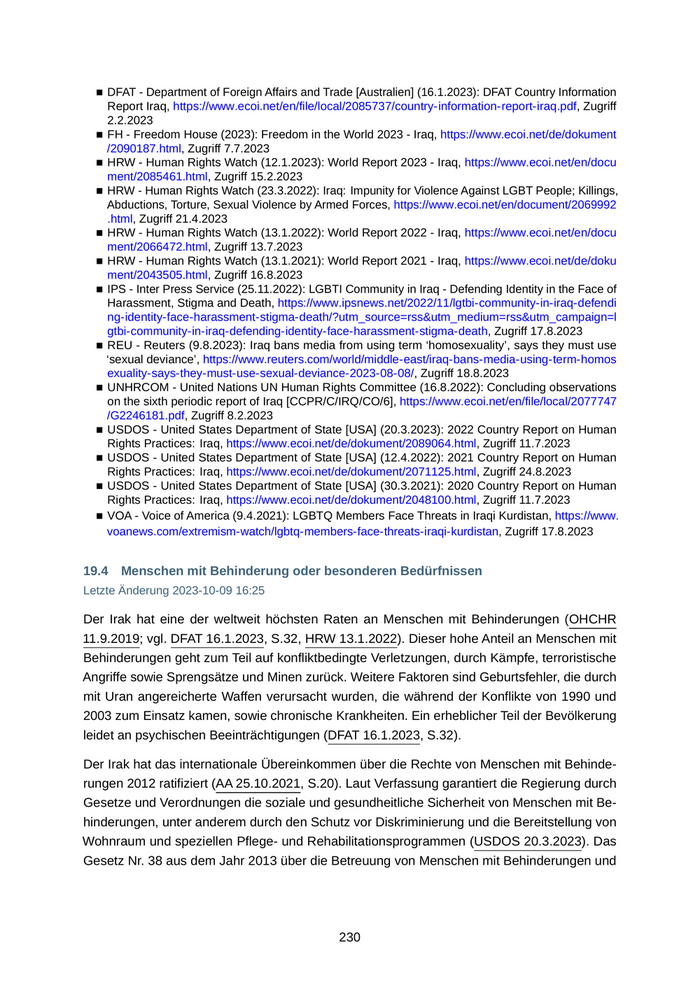
besonderen Bedürfnissen wird mangelhaft umgesetzt (OHCHR 11.9.2019). Trotz dieser Verfas sungsgarantien gibt es keine Gesetze, welche die Diskriminierung von Menschen mit körperli chen, sensorischen, geistigen oder psychischen Behinderungen verbieten (USDOS 20.3.2023). Menschen mit Behinderungen haben nur begrenzten Zugang zu Beschäftigung (USDOS 20.3.2023). Es gibt Beschäftigungsquoten für Arbeitnehmer mit Behinderungen im öffentlichen und privaten Sektor (DFAT 16.1.2023, S.32-33). Im öffentlichen Sektor ist es eine 5 %-Quote für invalide Personen (USDOS 20.3.2023), im privaten Sektor ist es eine 3 %-Quote (DFAT 17.8.2020, S.48). Dieselben gesetzlichen Quoten gelten in der Kurdistan Region Irak (KRI) (USDOS 20.3.2023). Diskriminierung bei der Beschäftigung besteht jedoch weiterhin (USDOS 20.3.2023). Das Arbeitsministerium betreibt jedoch mehrere Einrichtungen für Kinder und junge Erwachsene mit Behinderungen (USDOS 20.3.2023). Menschen mit Behinderungen haben Schwierigkeiten beim Zugang zu Bildung, Beschäftigung, Gesundheitsdiensten, Informationen, Kommunikation, Gebäuden, Verkehrsmitteln, dem Justiz system oder anderen staatlichen Dienstleistungen (USDOS 20.3.2023). Das Arbeitsministerium des Irak leitet eine unabhängige Kommission für die Betreuung von Men schen mit Behinderungen. In der KRI leitet der stellvertretende Minister für Arbeit und Soziales eine vergleichbare Kommission, die von einem eigenen Direktor innerhalb des Ministeriums verwaltet wird. Jeder irakische Staatsbürger, der sich um staatliche Dienstleistungen im Zusam menhang mit Behinderungen bewirbt, muss zunächst eine Kommissionsbewertung erhalten (USDOS 20.3.2023). Stigmatisierung, geografische Entfernung und Zugänglichkeit halten Be richten zufolge viele Menschen mit Behinderungen davon ab, sich für Leistungen zu registrieren (DFAT 16.1.2023, S.33). Insgesamt haben Menschen mit Behinderungen nur begrenzten Zugang zu Bildung, Beschäftigung und Gesundheitsdiensten, Informationen, Kommunikation, Gebäu den, Verkehrsmitteln, dem Justizsystem oder anderen staatlichen Dienstleistungen (USDOS 20.3.2023). Menschen mit Behinderungen sind in Höhe von 10 % ihres Einkommens von der Steuer befreit und haben Anspruch auf zinsgünstige Darlehen und monatliche Geldleistungen, die ihren Be dürfnissen entsprechen. Vollzeitpflegekräfte, die nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, erhalten ein monatliches Gehalt in der Höhe des Mindestlohns des öffentlichen Dienstes (DFAT 17.8.2020, S.48). Für Menschen mit körperlichen Behinderungen stehen zusätzlich öffentlich finanzierte Hilfsmittel (wie Rollstühle, Krücken und Stöcke) zur Verfügung, die jedoch Berichten zufolge einen sehr niedrigen Standard aufweisen (DFAT 16.1.2023, S.33). Im Jahr 2009 wurde Gesetz 20 erlassen (Änderungen 2015 und 2019), das erstmals Opfern u.a. von Militäroperationen, militärischen Irrtümern und terroristischen Akten Kompensationen zuspricht (MRG 21.1.2020, S.12; vgl. BS 23.2.2022, S.25). Dies gilt auch für teilweise oder voll ständige Invalidität. Bei einer Invalidität von 75-100 % kann den Opfern entweder eine einmalige Zahlung von fünf Millionen Irakischen Dinar (IQD) [Anm.: ca. 2.894 EUR] oder eine monatliche Zuwendung gewährt werden. Bei einer Invalidität von 50-75 % beträgt der Zuschuss drei bis 4,5 Millionen IQD [Anm.: ca. 1.737-2.605 EUR], bei einer Invalidität von weniger als 50 % beträgt der 231