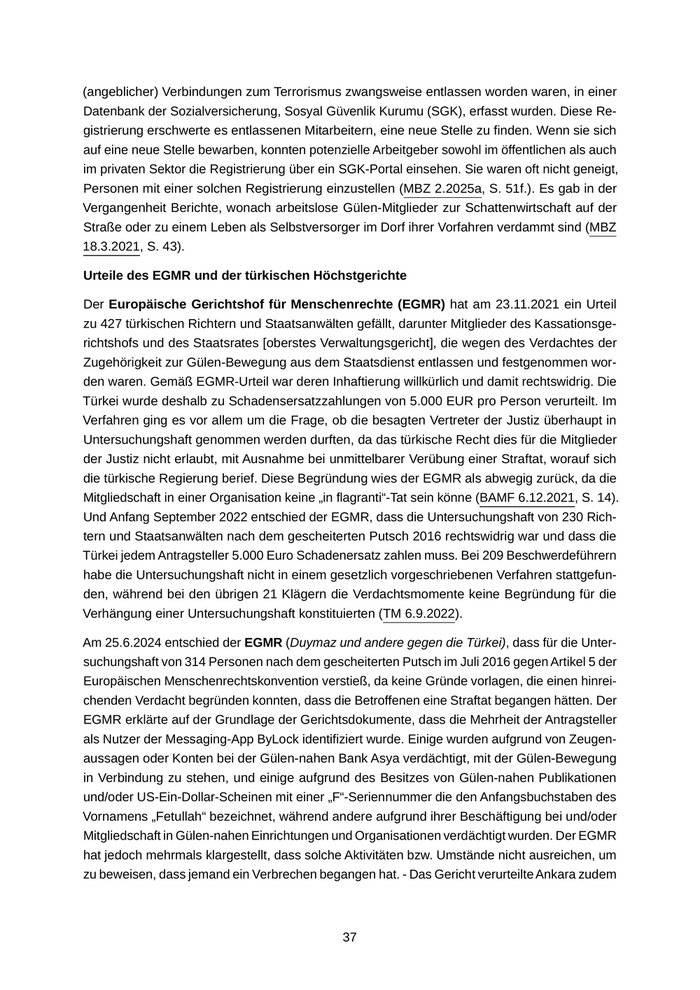2025-09-05-coi-cms-laenderinformationen-tuerkei-version-10-d827
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Länderinformationsblätter“
säkularen, kemalistischen Kräften in der Türkei. Sie hatten beide das Ziel, die Türkei in ein vom türkischen Nationalismus und einer starken, konservativen Religiosität geprägtes Land zu verwandeln. Selbst nicht in die Politik eintretend, unterstützte Gülen die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) bei deren Gründung und späteren Machtübernahme, auch indem er seine Anhänger in diesem Sinne mobilisierte (MEE 25.7.2016). Gülen-Anhänger hatten viele Positionen im türkischen Staatsapparat inne, die sie zu ihrem eigenen Vorteil nutzten, und wel che die regierende AKP tolerierte (DW 13.7.2018). Erdoğan nutzte wiederum die bürokratische Expertise der Gülenisten, um das Land zu führen und dann, um das Militär aus der Politik zu drängen. Nachdem das Militär entmachtet war, begann der Machtkampf (BBC 21.7.2016). Die Allianz zwischen AKP und Gülen-Bewegung erreichte ihren Höhepunkt während des Verfas sungsreferendums vom 12.9.2010, das die Zusammensetzung der Justizorgane veränderte und letztlich die säkularistische Kontrolle über die Justiz brach. Die beiden, AKP und Gülenisten, kooperierten insbesondere bei den Ergenekon- und Sledgehammer-Prozessen, die Hunderte von aktiven und pensionierten Militärs ins Gefängnis brachten, was die Befehlsgewalt des Mi litärs neu bestimmte (Taş 16.5.2017, S. 4). Manipulierte Beweisstücke, geheime Zeugen und etliches mehr während der Ermittlungen bildeten nicht selten die Basis jener Schauprozesse, die von der türkischen Polizei und der Staatsanwaltschaft seit 2007 vorbereitet wurden (Qantara 30.9.2013). Insbesondere das Gesetz über anonyme Zeugen aus 2008 wurde vor allem von der Gülen-Bewegung genutzt. Die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Sondergerichte konnten jeden Fall, den sie wollten, in Zusammenarbeit einleiten und die gewünschte Entscheidung herbeiführen. Die AKP hat diese Situation in jeder Hinsicht unterstützt (Mezopotamya 2.8.2022). Die Ermittlungen wurden von einer kleinen Gruppe von Gülen-Anhängern bei der Polizei und in den unteren Rängen der Justiz durchgeführt, medial unterstützt von den Gülen-nahen Medien (Jenkins/CACI-SRSP 15.4.2014; vgl. Cagaptay o.D., S. 31), welche gleichzeitig Regierungschef Erdoğan als einen Demokraten darstellten, der gegen die Eliten und einen ruchlosen „ tiefen Staat“ kämpft (Cagaptay o.D., S. 31f). Der Gülen-Bewegung war es somit gelungen, einen Staat im Staate zu etablieren, indem sie die Sicherheitskräfte ebenso unterwanderte wie den Justizapparat und die Verwaltung. Der Einfluss der Bewegung innerhalb der Justiz, gedeckt von der regierenden AKP, stellte sicher, dass die Verfehlungen ihrer Anhänger, z. B. Manipulati on von Beweisstücken in Verfahren zwecks Verfolgung politischer Gegner, ungesühnt blieben (Qantara 30.9.2013; vgl. Jenkins/CACI-SRSP 15.4.2014). Laut Türkei-Spezialisten, wie Gareth Jenkins, sind die Beweise - einschließlich Geständnissen - dafür, dass eine Komplottgruppe von Gülen-Anhängern hinter Fällen wie Ergenekon, Sledgehammer und dem Spionagering von Izmir steckte, inzwischen so umfassend, dass sie unwiderlegbar sind (Jenkins/CACI-SRSP 15.4.2014). Schrittweise Kriminalisierung durch den Staat: von der kriminellen Vereinigung zur Ter rororganisation Im Dezember 2013 kam es zum offenen politischen Zerwürfnis zwischen der AKP und der Gü len-Bewegung, als Gülen-nahe Staatsanwälte und Richter Korruptionsermittlungen gegen die Familie Erdoğans (damals Ministerpräsident) sowie Minister seines Kabinetts aufnahmen (AA 24.8.2020, S. 4; vgl. DFAT 16.5.2025, S. 20). Erdoğan beschuldigte daraufhin Gülen und seine 28
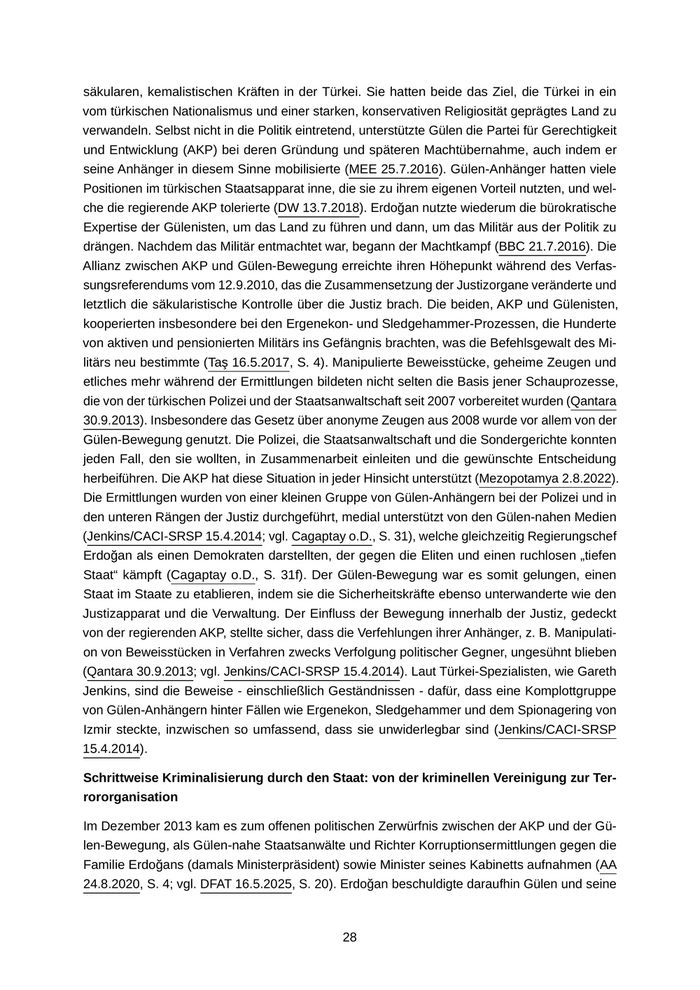
Anhänger, die AKP-Regierung durch Korruptionsuntersuchungen zu Fall bringen zu wollen, da mehrere Beamte und Wirtschaftsführer mit Verbindungen zur AKP betroffen waren, und Unter suchungen zu Rücktritten von AKP-Ministern führten (MEE 25.7.2016). In der Folge versetzte die Regierung die an den Ermittlungen beteiligten Staatsanwälte, Polizisten und Richter (BPB 1.9.2014) und begann schon seit Ende 2013 darüber hinaus, in mehreren Wellen Zehntausende mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung in diversen staatlichen Institutionen zu suspen dieren, zu versetzen, zu entlassen oder anzuklagen. Die Regierung verfolgte ferner unter dem Vorwand der Unterstützung der Gülen-Bewegung Journalisten strafrechtlich und zerschlug Me dienkonzerne, Banken sowie andere Privatunternehmen durch die Einsetzung von Treuhändern und enteignete diese teilweise (AA 24.8.2020, S. 4; vgl. DFAT 16.5.2025, S. 20). Ein türkisches Gericht hatte im Dezember 2014 einen Haftbefehl gegen Fethullah Gülen erlas sen. Die Anklage beschuldigte die Gülen-Bewegung, eine kriminelle Vereinigung zu sein. Zur gleichen Zeit ging die Polizei gegen mutmaßliche Anhänger Gülens in den Medien vor (Standard 20.12.2014). Die Sicherheitskräfte waren landesweit mit einer Großrazzia gegen Journalisten und angebliche Regierungsgegner bei der Polizei vorgegangen (DW 14.12.2014). Am 27.5.2016 verkündete Staatspräsident Erdoğan, dass die Gülen-Bewegung auf Basis einer Entscheidung des Nationalen Sicherheitsrates vom 26.5.2016 als terroristische Organisation registriert wird (HDN 27.5.2016). Mitte Juni 2017 definierte das Kassationsgericht die Gülen-Bewegung als bewaffnete terroristische Organisation. In dieser Entscheidung wurden auch die Kriterien für die Mitgliedschaft in dieser Organisation festgelegt (UKHO 1.2.2018, S. 8; vgl. Sabah 17.6.2017). Verbindungen zu Einrichtungen der Gülen-Bewegung In der Vergangenheit umfasste die Gülen-Bewegung in der Türkei verschiedene Einrichtungen wie Schulen, Studentenhäuser, Krankenhäuser sowie kulturelle und karitative Einrichtungen. Die herausragende Qualität und der gute Ruf dieser Institutionen zogen sowohl engagierte Gülenis ten als auch solche an, die der Bewegung nicht angehörten. Daher waren in der Vergangenheit Millionen von Menschen in der Türkei auf die eine oder andere Weise mit der Gülen-Bewegung verbunden. Angesichts dieses früheren Umfanges der Gülen-Bewegung war es nicht immer klar, wie die türkischen Behörden entschieden, gegen welche Gülenisten sie vorgehen sollten (MBZ 31.8.2023, S. 42). Folglich ist es durchaus möglich, dass jemand an einer Gülen-Einrich tung studiert, für diese gearbeitet, oder etwa ein Konto bei der Asya Bank (galt als Hausbank der Gülen-Bewegung) gehabt hat, ohne Gülenist im ideologischen Sinne zu sein. Eine solche Person kann dennoch mit der Gülen-Bewegung in Verbindung gebracht werden und infolge dessen persönliche Probleme mit den Behörden bekommen. Umgekehrt konnten in einigen Fällen wohlhabende tatsächliche oder angebliche Gülenisten persönliche Probleme mit den Behörden vermeiden, indem sie Beamte bestachen. Diese Praxis ist als FETÖ Borsası (wörtlich „ FETÖ-Börse“) bekannt. Durch die Zahlung von Bestechungsgeldern oder die Übergabe eines Unternehmens konnte ein (mutmaßlicher) Gülenist erreichen, dass sein erzwungener berufli cher Rücktritt rückgängig gemacht oder er von der Fahndungsliste gestrichen wurde. Zudem gab es Fälle von AKP-Politikern, die Verbindungen zur Gülenbewegung hatten, aber durch ihren politischen Einfluss einer strafrechtlichen Verfolgung entrannen (MBZ 2.3.2022, S. 36, 38). 29
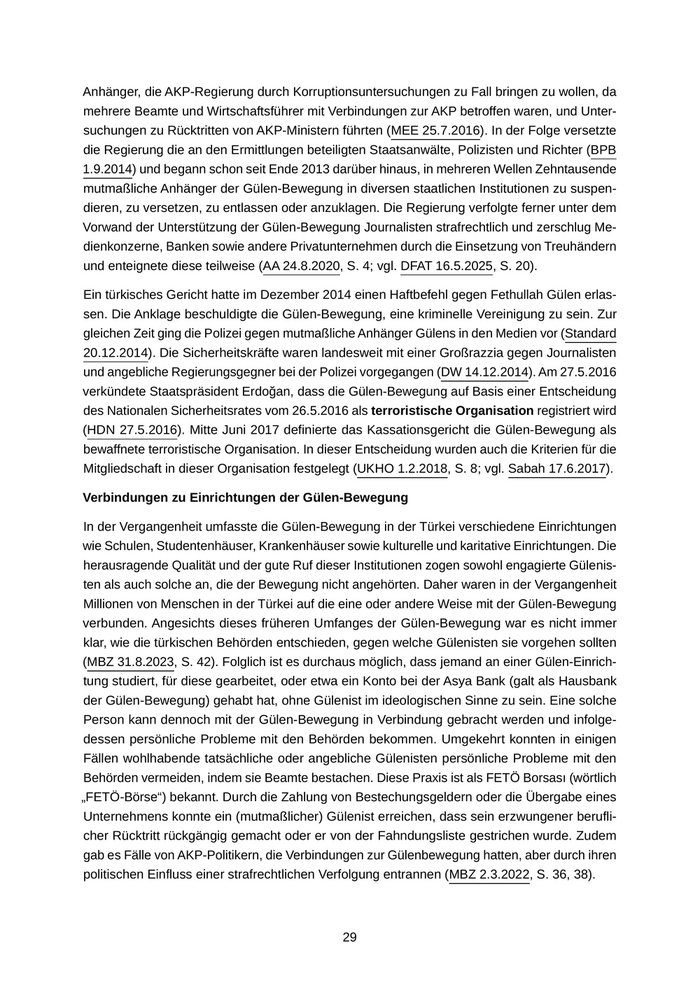
Die türkische Regierung beschuldigt die Gülen-Bewegung, hinter dem Putschversuch vom 15.7.2016 zu stecken, bei dem mehr als 250 Menschen getötet wurden. Für eine Beteiligung gibt es zwar zahlreiche Indizien, eindeutige Beweise aber ist die Regierung in Ankara bislang schuldig geblieben (DW 13.7.2018). Fethullah Gülen selbst verurteilte den Putschversuch und leugnete jede Beteiligung (MBZ 2.2025a, S. 45). Die Gülen-Bewegung wird von der Türkei als „ Fetullahçı Terör Örgütü – (FETÖ)“, „ Fetullahistische Terror Organisation“, tituliert, meist in Kombination mit der Bezeichnung „ Paralel Devlet Yapılanması (PDY)“, die „ Parallele Staatsstruktur“ bedeutet (AA 20.5.2024, S. 4; vgl. UKHO 1.2.2018, S.6). Die EU stuft die Gülen-Bewegung weiterhin nicht als Terrororganisation ein und steht auf dem Standpunkt, die Türkei müsse substanzielle Beweise vorlegen, um die EU zu einer Änderung dieser Einschätzung zu bewegen (Standard 30.11.2017; vgl. Presse 30.11.2017). Auch für die USA ist die Gülen- bzw. Hizmet-Bewegung keine Terrororganisation (TM 2.6.2016). Ausmaß der Verfolgung Viele der nach dem Putschversuch von 2016 festgenommenen Personen sollen in Haft gefol tert worden sein. Amnesty International und Human Rights Watch dokumentierten Fälle von Schlägen, Zwangsstellungen, Verweigerung von Nahrung, Wasser und medizinischer Versor gung, Scheinhinrichtungen, sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen. Die Folter wurde in der Regel von Polizisten verübt, häufig während Verhören in informellen Haftanstalten und manchmal unter Aufsicht von Polizeiarztinnen und -ärzten. Zu den Opfern gehörten Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Soldaten und andere Beamte. Die Inhaftierten waren auch anderen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, darunter die Verweigerung des Zugangs zu oder der Wahl von Rechtsanwälten und die Inhaftierung über lange Zeiträume ohne Anklage. Im Jahr 2019 gab es glaubwürdige Berichte über das Verschwinden und die Folterung mutmaßlicher Gülen-Anhänger, die ehemalige Mitarbeiter des Außenministeriums waren (DFAT 16.5.2025, S. 21). Laut Medienberichten zum achten Jahrestag (2024) des Putschversuches im Juli 2016 wurden seither 705.172 Personen, die mit der Gülen-Bewegung in Verbindung gebracht werden, ge richtlich belangt. 125.456 Personen wurden verurteilt und 104.448 Personen freigesprochen. Inhaftiert sind 13.251 Gülen-Mitglieder, darunter 10.365 rechtskräftig Verurteilte. Gegen 61.796 Personen laufen noch Ermittlungen. 23.052 befinden sich in Verfahren vor unteren Gerich ten. 357.205 Ermittlungen wurden ohne Anklageerhebung abgeschlossen. 1.634 vermeintli che Gülen-Mitglieder wurden in 289 Verfahren im Zusammenhang mit dem Putschversuch zu schweren lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt, weitere 1.366 erhielten lebenslange Haftstra fen und 1.891 verbüßen unterschiedlich lange Gefängnisstrafen (TR-Today 15.7.2024; vgl. TM 10.4.2021). Im Dezember 2023 bestätigte das Kassationsgericht (Oberstes Appellationsgericht) die erschwerte lebenslange Haft in 77 Fällen. Von in Summe 469 Verurteilungen bestätigte das Gericht 430, während 39 freigesprochen wurden (Duvar 19.12.2023; vgl. TM 19.12.2023). Im Zuge der massiven Verfolgung nach dem gescheiterten Putschversuch vom Juli 2016 wur den - die Zahlen variieren - über 540.000 Personen (zeitweise) festgenommen (SCF 5.10.2020). Annähernd 23.900 Armeeangehörige (TR-Today 15.7.2024), darunter 150 der 326 Generäle 30
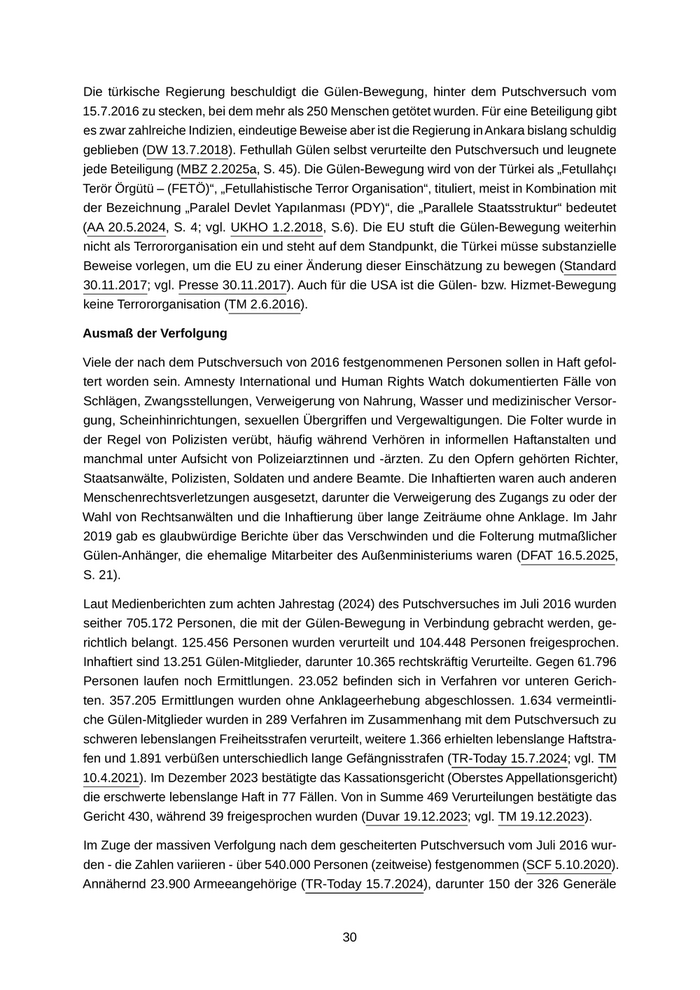
und Admirale, 4.145 Richter und Staatsanwälte (SCF 5.10.2020), 40.000 Polizeibeamte (TR- Today 15.7.2024) und mehr als 5.000 Akademiker wurden entlassen. Über 160 Medien, mehr als 1.000 Bildungseinrichtungen und fast 2.000 NGOs wurden ohne ordentliches Verfahren ge schlossen (SCF 5.10.2020). 150.000 öffentlich Bedienstete, inklusive Wissenschaftler, wurden entlassen (MEI 20.10.2022, S2; vgl. SCF 5.10.2020). Seit Juli 2016 hat die Regierung etwa 1.000 Unternehmen beschlagnahmt oder Verwalter für diese ernannt, denen Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen werden, zuletzt auch 2025. Seit 2016 (bis 2023) wurden Ver mögenswerte im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar von mutmaßlichen Gülen-Anhängern beschlagnahmt (DFAT 16.5.2025, S. 21). Die türkischen Behörden machten unmittelbar nach dem Tode von Fethulla Gülen am 20.10.2024 klar, dass sie ihren Kampf gegen die Gülen-Bewegung unvermindert fortsetzen würden. Bereits am 21.10.2024 kündigte Außenminister Hakan Fidan an, dass die Regierung in ihrem Kampf gegen die Gülen-Bewegung nicht nachlassen werde (MBZ 2.2025a, S. 45f.). Das Verteidigungs ministerium forderte die Gülen-Anhänger auf, sich unverzüglich zu ergeben (Duvar 22.10.2024). Die systematische Strafverfolgung mutmaßlicher Gülen-Anhängeri dauert folglich weiterhin an. Die sogenannten „ Säuberungsmaßnahmen“ zielen darauf ab, diese Personen aus allen rele vanten Institutionen zu entfernen (BAMF 4.11.2024b, S. 4; vgl. TM 3.12.2024). Die Verhaftungen erfolgen in Wellen und können sich über das ganze Land erstrecken. Oft genügen zur Einlei tung einer Strafverfolgung schon Informationen von Dritten, dass eine angeführte Person der Gülen-Bewegungangehört oder ihr nahesteht. Betroffen sind auch österreichische Staatsbürger sowie türkische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Österreich (ÖB Ankara 28.12.2023, S. 29). Im Juli 2024 nannte Justizminister Yerlikaya die Zahl von 9.738 Personen, welche etwa innerhalb eines Jahres bei 6.025 Einsätzen festgenommen wurden (HDN 15.7.2024; vgl. AnA 17.7.2024), wobei die Gerichte die Inhaftierung von rund 1.500 Personen anordneten und über 1.750 Frei gelassene gerichtliche Aufsichtsmaßnahmen verhängten (TM 26.5.2024; vgl. BAMF 29.7.2024, S. 10). Exemplarisch sind wegen der schieren Anzahl hier nur die umfangreichsten Operationen gegen vermeintliche Gülen-Mitglieder seit Herbst 2024 [letzte Teilaktualisierung der Länderinformatio nen] angeführt, wobei es nicht bloß um die Anzahl, sondern auch um die Art der Vorwürfe und Personengruppen geht. - Weiter zurückliegende Beispiele finden sich in älteren Versionen der Länderinformationen zur Türkei: Mitte Oktober 2024 wurden 13 Personen mit Verbindung zur Gülen-Bewegung in Manisa festge nommen, und gleichzeitig gab die Generalstaatsanwaltschaft in der Hauptstadt Ankara bekannt, dass zwölf von 33 Verdächtigen, die im Zusammenhang mit der Unterwanderung der türkischen Land- und Luftstreitkräfte festgenommen worden waren, sich für eine Zusammenarbeit mit den Behörden entschieden und 133 Personen als Mitglieder der Gülen-Bewegung identifizierten (DS 16.10.2024). Innenminister Yerlikaya gab Mitte November bekannt, dass bei Einsätzen in 66 Provinzen 459 Verdächtige festgenommen wurden. Laut Minister seien die Verdächtigen auch an der Propaganda der Gülen-Bewegung [offizielle Diktion der Quelle: „Terrorgruppe“] in den sozialen Medien beteiligt gewesen und hätten über öffentliche Telefone miteinander kommuni ziert, eine Methode, die häufig eingesetzt würde, um nicht entdeckt zu werden. Sie nutzten auch 31
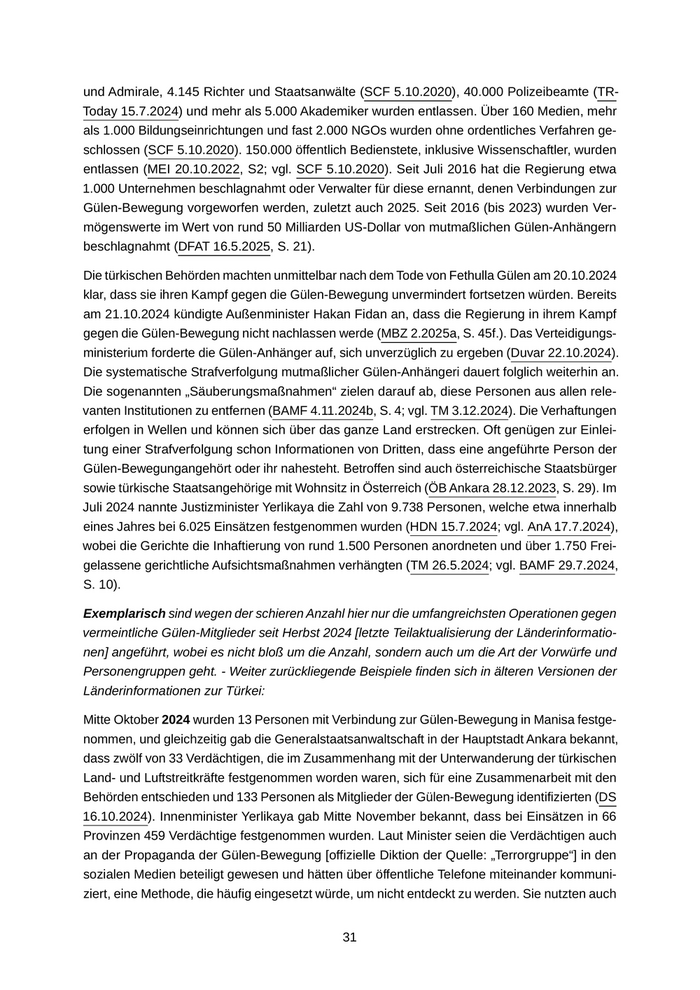
ByLock, so der Innenminister (DS 19.11.2024; vgl. SCF 19.11.2024). Im Dezember 2024 gab es mehrere Verhaftungswellen: Am 10. Dezember wurden 24 Verdächtige festgenommen. 21 von ihnen sollen 2012 an der Manipulation öffentlicher Personalauswahlprüfungen beteiligt gewesen sein. Ein weiterer Verdächtiger, angeblich der Buchhalter der Stadt Konya, wurde als Nutzer von ByLock verhaftet, während gegen zwei weitere Verdächtige ermittelt wird, weil sie sich in Gülen-Studentenwohnheimen aufhielten und die ByLock-App verwendeten (DS 10.12.2024). Am 18. Dezember wurden laut Innenminister in neun Provinzen 41 vermeintliche Gülen-Mit glieder als Bestandteil eines angeblich geheimen Netzwerkes in der Armee bzw. den Behörden verhaftet, die überdies laufende Verbindungen zu hochrangigen flüchtigen Gülen-Funktionären gehabt hätten (DS 18.12.2024). Und am 24. Dezember wurden 31 Gülen-Verdächtige in der Provinz Izmir festgenommen (DS 24.12.2024). Auch 2025 setzten sich die Verhaftungen von vermeintlichen Gülen-Mitgliedern oder -Unterstützern fort. - Am 7. Jänner wurde berichtet, dass 22 von 37 gesuchten Verdächtigen festgenommen wurden. Sie waren vermeintlich Teil eines Firmennetzwerkes, welches die Gülenbewegung finanziert. Sie wurden laut Behördenangaben durch Aussagen ehemaliger Gülen-Mitglieder, die mit den Behörden zusammengearbeitet haben, sowie durch Finanzermittlungen und Unter suchungen digitaler Beweise, die bei früheren Ermittlungen sichergestellt wurden, identifiziert. Die Verdächtigen hätten über Kuriere Bargeld sowohl an Gülen-Mitglieder, die wegen ihrer Verbindungen zur Gruppe inhaftiert sind, als auch an deren Familien übermittelt (DS 7.1.2025; vgl. SCF 10.1.2025, TM 10.1.2025). Bereits am 10. Jänner verkündete der Innenminister die Verhaftung weiterer 63 Personen bei Operationen in 38 Provinzen (SCF 10.1.2025; vgl. TM 10.1.2025), und am 14.Jänner die Festnahme von weiteren 110 Verdächtigen in 23 Provinzen, welche zum akademischen und militärischen Netzwerk der Gülen-Bewegung gehören sollen (DS 14.1.2025; vgl. SCF 14.1.2025). Bereits am 18. Jänner vermeldete das Innenministerium die Festnahme von 47 Verdächtigen in 23 Provinzen im Rahmen der „ KISKAÇ-35“-Operationen (TC-İB 18.1.2025) und am 24.1.2025 die Festnahme im Zuge der „ KISKAÇ-36“-Operationen von 71 Verdächtigen in 23 Provinzen (TC-İB 24.1.2025; vgl. DS 24.1.2025, SCF 24.1.2025). Am 21.2.2025 verhaftete die Polizei insgesamt 353 Personen, darunter auch zehn Beamte, die verdächtigt werden, der Gülen-Bewegung anzugehören. Die Verdächtigen wurden bei Razzien in 31 Städten festgenommen. Ihnen wird laut Innenminister vorgeworfen, eine Dö ner-Kebab-Restaurantkette benutzt zu haben, um Geld für die Gülenbewegung zu sammeln (DS 21.2.2025; vgl. SCF 21.2.2025, C8 22.2.2025). Bei Operationen zwischen dem 19. und 27. März in 27 Provinzen wurden 73 Personen festgenommen. Hiervon wurden 48 inhaftiert, 16 unter richterlicher Aufsicht freigelassen und gegen den Rest wurde weiter ermittelt. In nenminister Yerlikaya sagte, die Festgenommenen stünden im Verdacht, über Münztelefone Kontakt zu halten, die verschlüsselte Nachrichten-App ByLock zu benutzen und Inhalte der Gülen-Bewegung in sozialen Medien zu verbreiten. Einige Personen wurden auch beschuldigt, Teil der angeblichen „ militärischen und aktuellen Strukturen“ der Gülen-Bewegung zu sein oder sie finanziell zu unterstützen (TM 4.4.2025; vgl. TC-İB 4.4.2025). Am 5. Mai verkündete die Polizei von Ankara die Verhaftung von 33 vermeintlichen Gülenisten, wovon 20 in öffentlichen Einrichtungen arbeiteten. Die Verdächtigen sollen für die Rekrutierung neuer Mitglieder und die Überprüfung deren Loyalität zuständig gewesen sein (DS 5.5.2025; vgl. Hürriyet 5.5.2025). In 32
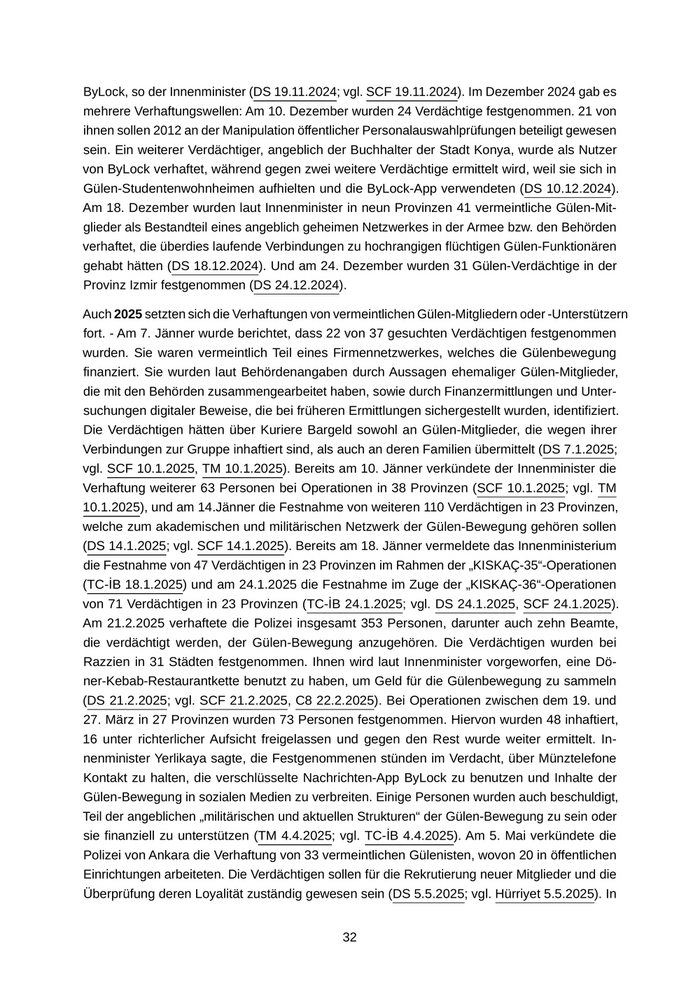
der ersten Mai-Hälfte wurden in weiteren Operationen in 47 Provinzen, vor allem in Gaziantep, 225 Verdächtige festgenommen. Am 10.5.2025 wurden vier weitere vermeintliche Gülen-Mit glieder verhaftet, wobei die Behörden behaupteten, dass es sich um eine Gruppe handle, die Reisen von jungen Türken in Länder des Balkans (Albanien, Nordmazedonien, Bosnien und Montenegro) organisiere, wo diese in Kursen indoktriniert und rekrutiert würden (DS 11.5.2025; vgl. TR-Today 11.5.2025, TC-İB 6.5.2025). Bereits am 16.5.2025 gab das Innenministerium die Verhaftung weiterer 101 Personen bei Razzien in 27 Provinzen bekannt. Den Inhaftierten wurde vorgeworfen, über Münztelefone Kontakt zu Mitgliedern der Bewegung aufgenommen, die Bewegung finanziell unterstützt und Propaganda in sozialen Medien verbreitet zu haben (TC-İB 16.5.2025; vgl. SCF 16.5.2025). Und am 23.05.2025 wurden zeitgleich in 36 Provin zen Razzien gegen mutmaßliche Angehörige der Gülen-Bewegung durchgeführt, wobei 56 Militärangehörige in Untersuchungshaft genommen wurden (BAMF 26.5.2025, S. 9; vgl. DS 23.5.2025). Und Mitte Juni wurd innerhalb von zwei Tage 56 Personen festgenommen, wobei der Fokus auf die Zerschlagung der laut Behördenangaben geheimen Infrastruktur der Bewegung, ihrer Rekrutierungsbemühungen unter Jugendlichen und ihrer Fluchthelferringe, die illegale Grenzübertritte ermöglichten, gelegt wurde (SCF 17.6.2025). In der zweiten Junihälfte erfolgte eine größere Verhaftungswelle, bei der fast 250 Personen in über 40 Provinzen festgenommen wurden, darunter 163 aktive Militärangehörige inklusive mehreren Offizieren sowie 21 aktive und ehemalige Polizisten (SCF 24.6.2025; vgl. BIRN 24.6.2025, TM 24.6.2025). Gefahren für Rechtsvertreter Anwälte von angeblichen Gülen-Mitgliedern laufen Gefahr, selbst in den Verdacht zu gera ten, Verbindungen zur Gülen-Bewegung zu haben (MBZ 18.3.2021, S. 40f.). Im September 2020 wurden 47 Rechtsanwälte festgenommen, weil diese angeblich durch ihre Rechtsbera tung Gülen-Mitglieder unterstützt hätten (AlMon 16.9.2020; vgl. ICJ 14.9.2020). Siehe auch Kapitel:Rechtsstaatlichkeit / Justizwesen. Verfolgung von Nicht-Gülen-Mitgliedern als Gülenisten Mitunter werden „ Nicht-Gülenisten“ als Gülen-Mitglieder oder -Anhänger gebrandmarkt und von den Behörden als solche behandelt. In diesem Fall könnten beispielsweise Oppositionelle, Ge werkschaftsaktivisten, Journalisten und Akademiker, die sich kritisch über Regierung äußern, in Betracht kommen (MBZ 2.2025a, S. 50). Beispielsweise wurde die Anwältin Dilek Ekmek çi strafrechtlich verfolgt und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung in Untersuchungshaft genommen. Sie hatte sich u. a. kritisch über den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen in staatlichen Einrichtungen geäußert (MBZ 2.2025a, S. 50; vgl. MLSA 24.10.2024, Agos 31.1.2025). Ende Jänner 2025 entschied das Gericht die Freilassung von Ekmekçi nach 152 Tagen Haft. Sie wurde jedoch wegen „ wissentlicher und vorsätzlicher Unter stützung einer illegalen Organisation“ zu einem Jahr und 13 Monaten verurteilt und mit einer Ausreisesperre belegt (MLSA 31.1.2025; vgl. Agos 31.1.2025). Kriterien für die Verfolgung durch die Justiz 33
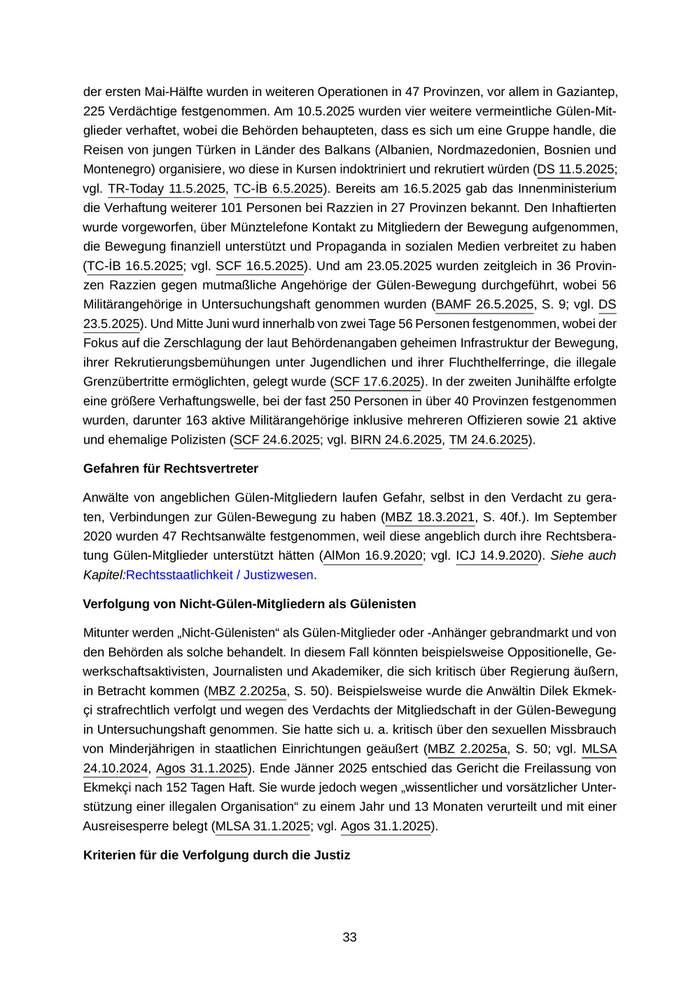
Menschenrechtsbeobachter haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass die türkische Regierung keine klaren Kriterien veröffentlicht hat, anhand derer Personen mit der Gülen-Bewegung in Verbindung gebracht werden können (DFAT 16.5.2025, S. 20; vgl. AA 20.5.2024). - Bereits am 3.9.2016 veröffentlichte die Tageszeitung Milliyet eine nicht erschöp fende „ Liste von sechzehn Kriterien“, die als Richtschnur für die Entlassung aus staatlichen Funktionen und für die Strafverfolgung dient. Personen, welche die angeführten Kriterien in unterschiedlichem Maße erfüllen, werden offiziellen Verfahren unterzogen und als „Terroristen“ bezeichnet - gefolgt von ihrer Festnahme oder Inhaftierung. Nach Angaben der Regierung war das Ziel der Erstellung einer solchen Liste, „ die Schuldigen von den Unschuldigen zu unterschei den“ (JWF 1.1.2019, S. 10). In der Regel reicht das Vorliegen eines der folgenden Kriterien, um eine strafrechtliche Verfolgung als mutmaßlicher Gülenist einzuleiten: Das Nutzen der verschlüs selten Kommunikations-App „ ByLock“; Geldeinlagen bei der Bank Asya nach dem 25.12.2013 (bis zu deren Schließung 2016) oder anderen Finanzinstituten der sogenannten „ parallelen Struktur“; Abonnement bei der Nachrichtenagentur Cihan oder der Zeitung Zaman; Spenden an Gülen-Strukturen zugeordnete Wohltätigkeitsorganisationen (AA 20.5.2024, S. 6f.; vgl. MBZ 2.3.2022, S. 38, JWF 1.1.2019, S.11, Statewatch/Turkut/Yıldız 11.2021, S. 10f.), wie der einst größten Hilfsorganisation des Landes „ Kimse Yok Mu“ (JWF 1.1.2019, S.11); der Besuch der eigenen Kinder von Schulen, die der Gülen-Bewegung zugeordnet werden; Kontakte zu Gülen zugeordneten Gruppen/Organisationen/Firmen, inklusive Beschäftigungsverhältnisse und die Teilnahme an religiösen Versammlungen der Gülen-Bewegung (AA 20.5.2024, S. 7; vgl. JWF 1.1.2019, S. 11, Statewatch/Turkut/Yıldız 11.2021, S. 10f.). Weitere Kriterien sind u. a.: die Unter stützung der Gülen-Bewegung in Sozialen Medien, der mehrmalige Besuch von Internetseiten der Gülen-Bewegung und die Nennung durch glaubwürdige Zeugenaussagen, Geständnisse Dritter oder schlicht infolge von Denunziationen (JWF 1.1.2019, S. 11; vgl. Statewatch/Turkut/ Yıldız 11.2021, S. 10f.). Eine Verurteilung setzt in der Regel das Zusammentreffen mehrerer dieser Indizien voraus, wobei der Kassationsgerichtshof präzisiert hat, dass für die Mitglied schaft in einer bewaffneten Terrororganisation ein gewisser Bindungsgrad der Person an die Organisation nachgewiesen werden muss (AA 20.5.2024, S. 7). Der Kassationsgerichtshof ent schied im Mai 2019, dass weder das Zeitungsabonnement eines Angeklagten (SCF 6.8.2019) noch die Einschreibung seines Kindes in einer Gülen-Schule für eine Verurteilung ausreicht (AA 20.5.2024, S. 7; vgl. SCF 6.8.2019). Siehe zu den Kriterien weiter unten das Urteil des EGMR vom 3.12.2024 als Beispiel! Laut Eigenangaben differenzieren die türkischen Behörden unterschiedliche Schweregrade der Beteiligung an der Gülen-Bewegung. Im März 2020 erklärte die 16. Strafkammer des Ver fassungsgerichts, zuständig für Berufungen in allen Gülen-Fällen, dass es sieben Stufen der Beteiligung gäbe: Die erste Ebene besteht aus den Menschen, welche die Gülen-Bewegung aus guter Absicht (finanziell) unterstützten. Die zweite Schicht besteht aus einer loyalen Gruppe von Menschen, die in Gülen-Organisationen arbeiteten und mit der Ideologie der Gülen-Be wegung vertraut war. Die dritte Gruppe besteht aus Ideologen, die sich die Gülen-Ideologie zu eigen machten und in ihrem Umfeld verbreiteten. Die vierte Gruppe waren Inspektoren, die die verschiedenen Formen von Dienstleistungen der Gülen-Bewegung überwachten. Die fünfte Gruppe setzte sich aus Beamten zusammen, die für die Erstellung und Umsetzung der Politik 34
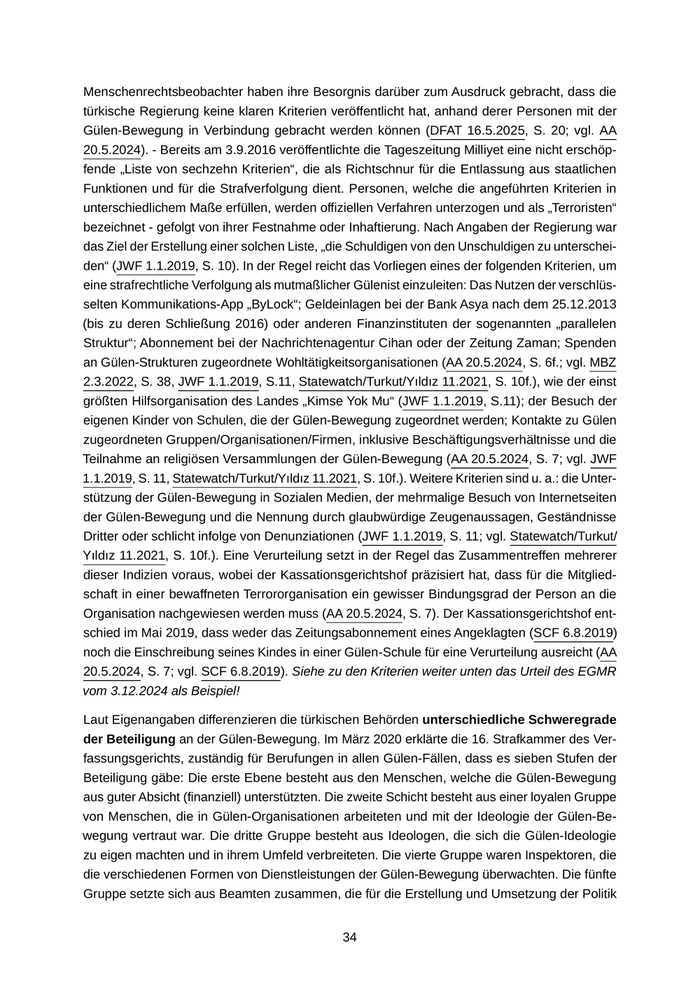
der Gülen-Bewegung verantwortlich war. Die sechste Gruppe bildet den elitären Kreis, der den Kontakt zwischen den verschiedenen Segmenten der Organisation aufrechterhielt bzw. dies immer noch tut, aber auch Personen aus ihren Positionen entlassen konnte. Die siebte Gruppe besteht aus siebzehn Personen, die direkt von Fethullah Gülen ausgewählt wurden und an der Spitze der Gülen-Bewegung stehen (MBZ 18.3.2021, S. 38f.). Während praktisch jeder mit einem Gülen-Hintergrund strafrechtlich belangt werden kann, stehen mutmaßliche Gülenisten im Sicherheitsapparat, wie Militärs und Gendarme, besonders im Visier. Auch Personen, die Führungspositionen in Gülen-Institutionen wie den Gülen-Schulen, der Fatih-Universität in Is tanbul und der Tageszeitung Zaman innehatten, fallen den Behörden eher negativ auf (MBZ 2.3.2022, S. 38). Die Entscheidung der türkischen Behörden, vermeintliche Gülen-Mitglieder strafrechtlich zu verfolgen, oder nicht, scheint sehr willkürlich zu sein (MBZ 2.3.2022, S. 39). Moderate Rich ter tendieren zwischen „ passiven“ und „ aktiven“ Gülen-Mitgliedern zu unterschieden, während Hardliner keine Unterscheidung hinsichtlich der Kriterien einer vermeintlichen Unterstützung oder Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung machen. Infolgedessen ist der Ausgang der Straf verfahren, insbesondere hinsichtlich des Strafausmaßes, willkürlich (MBZ 18.3.2021, S. 41). Zu dieser Unberechenbarkeit trägt u. a. der Umstand bei, dass die Behörden weder objektive Krite rien verwenden, noch sie diese konsequent anwenden (MBZ 2.3.2022, S. 39). Selbst Personen, die keine Gülenisten waren, wie Oppositionspolitiker, Menschenrechtsaktivisten und linke Ge werkschaftsmitglieder, wurden beschuldigt, Verbindungen zur Gülen-Bewegung zu haben (MBZ 31.8.2023, S. 43). Anlässlich des Todes von Fethullah Gülen am 20.10.2024 wurden Personen, die öffentlich ihr Beileid zum Ausdruck brachten strafrechtlich wegen Terrorismusunterstützung verfolgt. So wur de der Chefredakteur der Zeitung Yeni Asya, Kazım Güleçyüz, wegen einer diesbezüglichen Beileidsbekundung auf der Plattform „ X“ mit den Worten: „Allah habe ihn selig“ festgenom men (DTJ 28.10.2024; vgl. NaT 24.10.2024). Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft ordnete die Verhaftung von insgesamt 15 Verdächtigen an, von denen tatsächlich vier festgenommen wurden, weil sie Gülen in sozialen Medien nach seinem angeblichen Tod gelobt hatten (NaT 24.10.2024). Die Verwandten von hochrangigen Gülenisten sind besonders gefährdet, die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zu ziehen (MBZ 2.2025a, S.52). So wurde nebst Selahaddin Gülen, ein Neffe Fetullah Gülens, der bereits 2021 vom Nationale Nachrichtendienst MİT von Kenia in die Türkei verbracht wurde, auch Asiye Gülen, eine Nichte Fetullah Gülens, und deren Ehemann im Juni 2023 in Istanbul festgenommen (MBZ 31.8.2023, S.45). Und Mitte Juli 2023 verhafte ten die Istanbuler Polizei und der Geheimdienst MİT Selman Gülen, einen weiteren behördlich gesuchten Neffen Fetullah Gülens, die Frau des Ersteren, Nur Gülen, sowie deren Eltern (DS 14.7.2023). Generell sind Familienangehörige mutmaßlicher Gülen-Anhänger betroffen gewe sen, unter anderem durch Reiseverbote und/oder Passbeschlagnahmungen, das Einfrieren von Vermögenswerten und die Entlassung aus dem öffentlichen Dienst (DFAT 16.5.2025, S. 21). Es 35
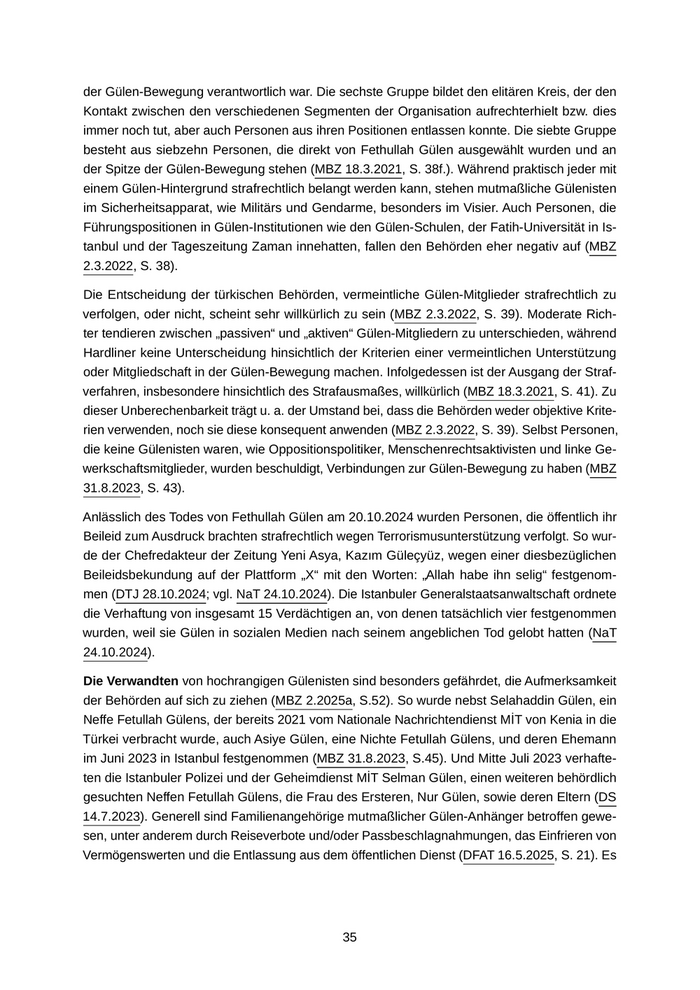
gab jedoch auch mehrere Fälle von Familien, die einen Gülen-Unterstützer in ihren Reihen hat ten, ohne dass die Angehörigen Probleme mit den türkischen Behörden hatten (MBZ 2.3.2022, S. 41). Die Strafverfolgungsbehörden wenden zur Identifizierung vermeintlicher Gülen-Mitglieder eine Überwachungs-Software an, die anhand von 78 Haupt- und 253 Sekundärkriterien Verdäch tigte ausfindig macht, das sog. „ FETÖ-Meter“ (TM 5.3.2021). Diese Kriterien sind in vier Kate gorien gruppiert, nämlich: jene, die unmittelbar den Kernbereich des Privatlebens der profilierten Person betreffen; diejenigen, die sich auf das Berufsleben (ab der Kadettenzeit) der Person be ziehen; diejenigen, die sich auf das soziale Umfeld und die Zugehörigkeit der profilierten Person beziehen; diejenigen, die sich auf die Verwandten der profilierten Person beziehen (Statewatch/ Turkut/Yıldız 11.2021). Zu den Kritierien gehören etwa Daten über den Bildungswerdegang, die Verwandtschaft und den Vermögensstand. Verdächtige Merkmale sind beispielsweise der Dienst in einer NATO-Vertretung im Ausland oder ein Doktorat. Bei Militärangehörigen gilt die eigene Hochzeit außerhalb von Gebäuden im Besitz des Militärs als Verdachtsmoment, weil unterstellt wird, dass dies der Verschleierung der Identitäten der Hochzeitsgäste diente (TM 5.3.2021). Das FETÖ-Meter sammelte zu Beginn insbesondere nachrichtendienstliche Daten aus allen Berei chen der Armee sowie aus Ministerien und Behörden, um mögliche, aus der Sicht der Behörden, Infiltratoren aufzuspüren. Die Ermittler untersuchten mit dem Tool u. a. etwa eine Million Han dynummern, die auf ehemalige und noch dienende Marineoffiziere registriert waren und fanden angeblich heraus, dass 1.500 von ihnen Nutzer der verschlüsselten Messenger-App „ ByLock“ waren. Ebenso wurden die Kontoinformationen von Offizieren bei der inzwischen aufgelösten Bank Asya zur Identifizierung verwendet (DS 12.9.2018). Der FETÖ-Meter inspirierte auch an dere staatliche Stellen zu einer ähnlichen Politik, wie die Sozialversicherungsanstalt (SGK), die seit vier Jahren mutmaßliche Gülen-Sympathisanten in ihrer Datenbank mit dem „ Code 36“ kennzeichnet. Die Kennzeichnung ist automatisch für jeden potenziellen Arbeitgeber sichtbar, was zu Befürchtungen bei denjenigen führt, die erwägen, eine dieser Personen einzustellen (TM 5.3.2021; vgl. DFAT 16.5.2025, S. 21). Die Entlassenen verlieren ihr Einkommen und ihre Sozialleistungen, darunter auch den Zugang zu Krankenversicherung und Pensionsleistungen (DFAT 16.5.2025, S. 21). Es ist ein soziales Stigma, ein Gülen-Mitglied zu sein, weshalb sich viele Bürger von ihnen distanzieren, und Bekannte innerhalb des sozialen Umfeldes von Gülen-Mitgliedern brechen die Kontakte ab (MBZ 31.8.2023, S. 44f.). Diese Haltung beruht nicht immer auf Hass und Ab neigung, sondern ist eine Form des Selbstschutzes, aus Angst strafrechtlich verfolgt zu werden, wenn sie mit Personen der Gülen-Bewegung in Verbindung gebracht werden (MBZ 2.3.2022, S. 41). Infolgedessen haben vermeintliche oder tatsächliche Gülen-Mitglieder auch ihren Ar beitsplatz verloren oder fanden keine (neue) Anstellung (MBZ 31.8.2023, S. 46). Auch das „ FETÖ-Meter“ wurde als Instrument, vor allem in der Armee, eingesetzt, um Personen zu entlas sen. Zu Entlassungen kam es selbst aufgrund einer Verwandtschaft (Ehepartners, Geschwister) mit einem angeblichen Gülen-Mitglied, das z. B. ein Konto bei der Asya Bank hatte oder ein angeblicher ByLock-Benützer war (Statewatch/Turkut/Yıldız 11.2021, S. 21-26). In der amtli chen Kundmachung vom März 2022 wurde bereits klargestellt, dass alle Personen, die wegen 36
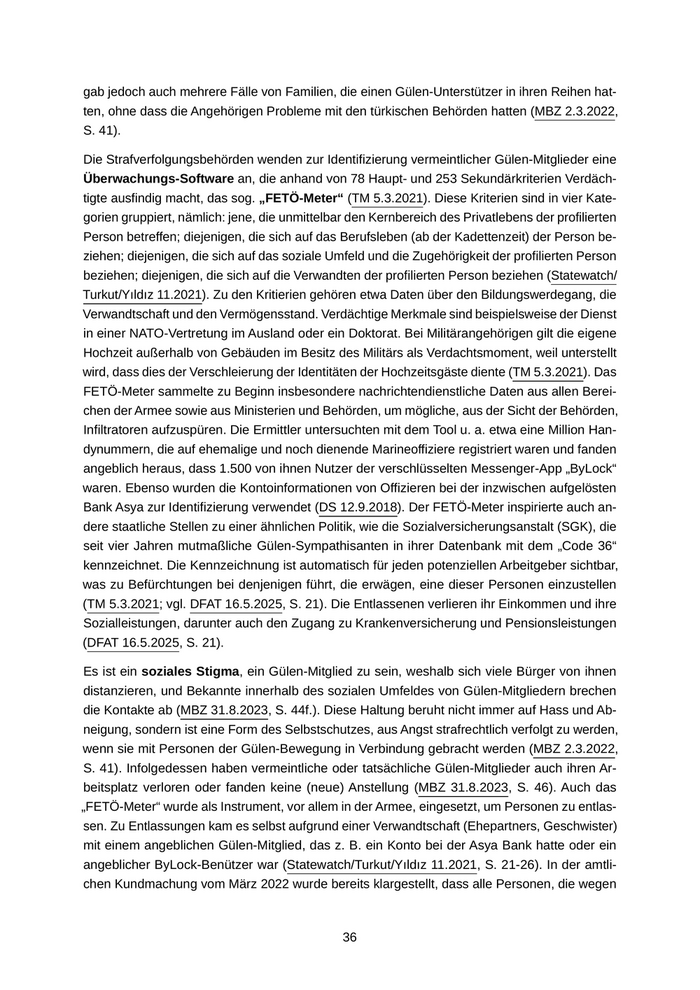
(angeblicher) Verbindungen zum Terrorismus zwangsweise entlassen worden waren, in einer Datenbank der Sozialversicherung, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erfasst wurden. Diese Re gistrierung erschwerte es entlassenen Mitarbeitern, eine neue Stelle zu finden. Wenn sie sich auf eine neue Stelle bewarben, konnten potenzielle Arbeitgeber sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor die Registrierung über ein SGK-Portal einsehen. Sie waren oft nicht geneigt, Personen mit einer solchen Registrierung einzustellen (MBZ 2.2025a, S. 51f.). Es gab in der Vergangenheit Berichte, wonach arbeitslose Gülen-Mitglieder zur Schattenwirtschaft auf der Straße oder zu einem Leben als Selbstversorger im Dorf ihrer Vorfahren verdammt sind (MBZ 18.3.2021, S. 43). Urteile des EGMR und der türkischen Höchstgerichte Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat am 23.11.2021 ein Urteil zu 427 türkischen Richtern und Staatsanwälten gefällt, darunter Mitglieder des Kassationsge richtshofs und des Staatsrates [oberstes Verwaltungsgericht], die wegen des Verdachtes der Zugehörigkeit zur Gülen-Bewegung aus dem Staatsdienst entlassen und festgenommen wor den waren. Gemäß EGMR-Urteil war deren Inhaftierung willkürlich und damit rechtswidrig. Die Türkei wurde deshalb zu Schadensersatzzahlungen von 5.000 EUR pro Person verurteilt. Im Verfahren ging es vor allem um die Frage, ob die besagten Vertreter der Justiz überhaupt in Untersuchungshaft genommen werden durften, da das türkische Recht dies für die Mitglieder der Justiz nicht erlaubt, mit Ausnahme bei unmittelbarer Verübung einer Straftat, worauf sich die türkische Regierung berief. Diese Begründung wies der EGMR als abwegig zurück, da die Mitgliedschaft in einer Organisation keine „ in flagranti“-Tat sein könne (BAMF 6.12.2021, S. 14). Und Anfang September 2022 entschied der EGMR, dass die Untersuchungshaft von 230 Rich tern und Staatsanwälten nach dem gescheiterten Putsch 2016 rechtswidrig war und dass die Türkei jedem Antragsteller 5.000 Euro Schadenersatz zahlen muss. Bei 209 Beschwerdeführern habe die Untersuchungshaft nicht in einem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren stattgefun den, während bei den übrigen 21 Klägern die Verdachtsmomente keine Begründung für die Verhängung einer Untersuchungshaft konstituierten (TM 6.9.2022). Am 25.6.2024 entschied der EGMR (Duymaz und andere gegen die Türkei), dass für die Unter suchungshaft von 314 Personen nach dem gescheiterten Putsch im Juli 2016 gegen Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstieß, da keine Gründe vorlagen, die einen hinrei chenden Verdacht begründen konnten, dass die Betroffenen eine Straftat begangen hätten. Der EGMR erklärte auf der Grundlage der Gerichtsdokumente, dass die Mehrheit der Antragsteller als Nutzer der Messaging-App ByLock identifiziert wurde. Einige wurden aufgrund von Zeugen aussagen oder Konten bei der Gülen-nahen Bank Asya verdächtigt, mit der Gülen-Bewegung in Verbindung zu stehen, und einige aufgrund des Besitzes von Gülen-nahen Publikationen und/oder US-Ein-Dollar-Scheinen mit einer „ F“-Seriennummer die den Anfangsbuchstaben des Vornamens „ Fetullah“ bezeichnet, während andere aufgrund ihrer Beschäftigung bei und/oder Mitgliedschaft in Gülen-nahen Einrichtungen und Organisationen verdächtigt wurden. Der EGMR hat jedoch mehrmals klargestellt, dass solche Aktivitäten bzw. Umstände nicht ausreichen, um zu beweisen, dass jemand ein Verbrechen begangen hat. - Das Gericht verurteilte Ankara zudem 37